4. Juli 2008
von Tom Levold
Keine Kommentare
 „Morus Markard ist der letzte Professor, der an der Freien Universität (FU) Berlin Lehrveranstaltungen zur Kritischen Psychologie anbietet und auch das nur per Lehrauftrag, der jedes Semester neu vergeben werden muss. Damit sollte nun nach dem Willen der FU Schluss sein. Begründung: Die FU müsse sich auf die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge vorbereiten. Durch eine Protestaktion konnten die Studierenden dafür sorgen, dass Markard den Lehrauftrag noch mal bekam“ So war im Februar 2007 auf der website keimform.de zu lesen. Schaut man auf der Uni-website nach, stellt man fest, dass Markard als außerplanmäßiger Professor im Arbeitsbereich Subjektforschung und Kritische Psychologie noch immer Lehrveranstaltungen anbietet. Auf der therapieschulenübergreifende Tagung„Das Unbehagen in der (Psychotherapie-)Kultur. Sinnverstehende Traditionen – Grundlagen und Perspektiven“, die am 17. und 18. März 2006 in Bonn stattfand, stellte Markard seine„subjektwissenschaftlichen Überlegungen zum Verhältnis von subjektiver Erfahrung und wissenschaftlicher Verallgemeinerung“ vor, die in einer überarbeiteten und erweiterten Fassung im Online-„Journal für Psychologie“ 3/2007 nachzulesen sind. In dieser unbedingt lesenswerten Arbeit geht es um das Verhältnis von Begriffen und Erfahrung, um die Mitteilbarkeit von Erfahrung, über das Verhältnis von Theorie und Praxis und die Folgerungen für das Denken über Therapie, das sich nicht dem nomothetischen Ursache-Wirkungs-Paradigma der Mainstream-Psychologie unterwirft:„Die Gesellschaft ist zwar ein reales System, durch das die Lebenserhaltung des einzelnen vermittelt ist; Gesellschaft als System ist aber für sich genommen kein anschaulicher, kein unmittelbarer Erfahrungstatbestand. Gesellschaftliche Verhältnisse strukturieren, vermittelt über verschiedene auch i.e.S. institutionelle Subsysteme, die Lebenstätigkeiten, Denkweisen und Erfahrungen der Gesellschaftsmitglieder. Diese Strukturiertheit ist selber aber nicht anschaulich, sondern nur, wenn man so will, rekonstruktiv zu ermitteln. Was (jeweils) zu rekonstruieren ist, ist der Vermittlungszusammenhang zwischen unmittelbarer Lebenswelt bzw. unmittelbar gegebener Situation und dem diese umgreifenden und strukturierenden gesellschaftlichen System. In unserem Zusammenhang zentral ist, dass das gesellschaftliche System und seine institutionellen Subsysteme auch die unmittelbaren und in ihrer lebensweltlichen Unmittelbarkeit durchaus auch anschaulich anmutenden sozialen Beziehungen unanschaulich strukturieren. Anschauliche soziale Beziehungen gehen in ihrer Anschaulichkeit nicht auf. Wie wir Männer, Frauen, Kinder wahrnehmen, hat biographische, situative und gesellschaftliche Dimensionen. Die Unanschaulichkeit von gesellschaftlichen Strukturen bedeutet eben keineswegs ihre Unerfahrbarkeit, sondern nur, dass Erfahrungen, sofern sie nicht auf diese Momente hin analysiert werden, unvollständig und schief analysiert werden. Wir müssen allerdings bedenken, dass es bezüglich dessen, was Gesellschaft ist, in welcher Art Gesellschaft wir leben, unterschiedliche, konkurrierende theoretische Rekonstruktionen und Reflexionen gibt. Daraus folgt, dass die Aufschlüsselung von Erfahrungen strittig sein muss. Ob man diese Gesellschaft als soziale Marktwirtschaft, als Risikogesellschaft, als Ambiente postmoderner Flaneure oder als ordinäre kapitalistische Barbarei betrachtet, ist umstritten, aber für die Aufschlüsselung von Erfahrung (bspw. von Arbeitslosigkeit oder Schulschwänzen) wesentlich, je nach Lage der Dinge auch praktisch relevant“
„Morus Markard ist der letzte Professor, der an der Freien Universität (FU) Berlin Lehrveranstaltungen zur Kritischen Psychologie anbietet und auch das nur per Lehrauftrag, der jedes Semester neu vergeben werden muss. Damit sollte nun nach dem Willen der FU Schluss sein. Begründung: Die FU müsse sich auf die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge vorbereiten. Durch eine Protestaktion konnten die Studierenden dafür sorgen, dass Markard den Lehrauftrag noch mal bekam“ So war im Februar 2007 auf der website keimform.de zu lesen. Schaut man auf der Uni-website nach, stellt man fest, dass Markard als außerplanmäßiger Professor im Arbeitsbereich Subjektforschung und Kritische Psychologie noch immer Lehrveranstaltungen anbietet. Auf der therapieschulenübergreifende Tagung„Das Unbehagen in der (Psychotherapie-)Kultur. Sinnverstehende Traditionen – Grundlagen und Perspektiven“, die am 17. und 18. März 2006 in Bonn stattfand, stellte Markard seine„subjektwissenschaftlichen Überlegungen zum Verhältnis von subjektiver Erfahrung und wissenschaftlicher Verallgemeinerung“ vor, die in einer überarbeiteten und erweiterten Fassung im Online-„Journal für Psychologie“ 3/2007 nachzulesen sind. In dieser unbedingt lesenswerten Arbeit geht es um das Verhältnis von Begriffen und Erfahrung, um die Mitteilbarkeit von Erfahrung, über das Verhältnis von Theorie und Praxis und die Folgerungen für das Denken über Therapie, das sich nicht dem nomothetischen Ursache-Wirkungs-Paradigma der Mainstream-Psychologie unterwirft:„Die Gesellschaft ist zwar ein reales System, durch das die Lebenserhaltung des einzelnen vermittelt ist; Gesellschaft als System ist aber für sich genommen kein anschaulicher, kein unmittelbarer Erfahrungstatbestand. Gesellschaftliche Verhältnisse strukturieren, vermittelt über verschiedene auch i.e.S. institutionelle Subsysteme, die Lebenstätigkeiten, Denkweisen und Erfahrungen der Gesellschaftsmitglieder. Diese Strukturiertheit ist selber aber nicht anschaulich, sondern nur, wenn man so will, rekonstruktiv zu ermitteln. Was (jeweils) zu rekonstruieren ist, ist der Vermittlungszusammenhang zwischen unmittelbarer Lebenswelt bzw. unmittelbar gegebener Situation und dem diese umgreifenden und strukturierenden gesellschaftlichen System. In unserem Zusammenhang zentral ist, dass das gesellschaftliche System und seine institutionellen Subsysteme auch die unmittelbaren und in ihrer lebensweltlichen Unmittelbarkeit durchaus auch anschaulich anmutenden sozialen Beziehungen unanschaulich strukturieren. Anschauliche soziale Beziehungen gehen in ihrer Anschaulichkeit nicht auf. Wie wir Männer, Frauen, Kinder wahrnehmen, hat biographische, situative und gesellschaftliche Dimensionen. Die Unanschaulichkeit von gesellschaftlichen Strukturen bedeutet eben keineswegs ihre Unerfahrbarkeit, sondern nur, dass Erfahrungen, sofern sie nicht auf diese Momente hin analysiert werden, unvollständig und schief analysiert werden. Wir müssen allerdings bedenken, dass es bezüglich dessen, was Gesellschaft ist, in welcher Art Gesellschaft wir leben, unterschiedliche, konkurrierende theoretische Rekonstruktionen und Reflexionen gibt. Daraus folgt, dass die Aufschlüsselung von Erfahrungen strittig sein muss. Ob man diese Gesellschaft als soziale Marktwirtschaft, als Risikogesellschaft, als Ambiente postmoderner Flaneure oder als ordinäre kapitalistische Barbarei betrachtet, ist umstritten, aber für die Aufschlüsselung von Erfahrung (bspw. von Arbeitslosigkeit oder Schulschwänzen) wesentlich, je nach Lage der Dinge auch praktisch relevant“
Zum vollständigen Text

 Im Open-Access-„Journal für Psychologie“ 1/2007 hat Kerstin Zühlke-Kluthke über ihre Untersuchung erklärender Zuschreibungen von Partnern in konflikthaften und nach beendeten Partnerschaften beschrieben (Abb. storytellersnetwork.wordpress.com):„Das zentrale Ziel dieser Arbeit bestand darin, auffällige Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Ursachenzuschreibung bei konflikthaften und gescheiterten Paarbeziehungen basierend auf attributionstheoretischen Ansätzen aufzuzeigen. Die Methode des qualitativen Interviews mit Nachfragteil hat sich bewährt, solche Attributionen hervorzulocken. Gerade diese offene Herangehensweise in Verbindung mit attributionstheoretischen Aspekten unterscheidet diese Arbeit von anderen Untersuchungen zu Attributionstheorien. Obwohl durch die geringe Anzahl der Interviews je Gruppe nur ein kleiner Ausschnitt an Attributionen in konflikthaften und gescheiterten Partnerschaften gezeigt werden konnte, sind doch auffällige Übereinstimmungen und Unterschiede sichtbar geworden. Die Untersuchung zeigt, dass Partner die Handlungen des anderen subjektiv interpretieren entsprechend ihrem individuellen Beziehungskonzept und der eigenen sowie gemeinsamen Lern- und Lebensgeschichte. Für beide gibt es keine objektive Wahrheit, sondern nur subjektive Wirklichkeiten. Ähnlich wie Eva Wunderer (2003) den Beginn einer Liebe durch verzerrte Wahrnehmung erklärt: der oder die Geliebte werden als einmalig und allen anderen als meilenweit überlegen erlebt, obgleich die Unterschiede zum Rest der Menschheit vielleicht gar nicht so groß sind (Wunderer 2003, 32), werden möglicherweise auch konflikthafte und gescheiterte Paarsituationen verzerrt wahrgenommen, was sich in entsprechenden Attributionen niederschlägt. Die Wahrnehmung weicht auch in diesen Fällen von der Realität in eine Richtung ab, die das gegenwärtige Empfinden in der Partnerschaft verstärkt. Die Ergebnisse der Auswertung der Interviews lassen vermuten, dass konfliktbelastete Paare ungünstiger attribuieren: mehr individuelle Aspekte statt situativer Aspekte. Durch vermehrte Negativattributionen wird das negative Gefühl zum Partner aufrechterhalten. Gerade bei den Paaren, die konflikthaft zusammenleben und ihre Partnerschaft retten wollen, bietet sich ein Re-attributionsverfahren an, was auf die Veränderung von Attributionen abzielt. Hier liegt die praktische Verwertbarkeit dieser Untersuchung“
Im Open-Access-„Journal für Psychologie“ 1/2007 hat Kerstin Zühlke-Kluthke über ihre Untersuchung erklärender Zuschreibungen von Partnern in konflikthaften und nach beendeten Partnerschaften beschrieben (Abb. storytellersnetwork.wordpress.com):„Das zentrale Ziel dieser Arbeit bestand darin, auffällige Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Ursachenzuschreibung bei konflikthaften und gescheiterten Paarbeziehungen basierend auf attributionstheoretischen Ansätzen aufzuzeigen. Die Methode des qualitativen Interviews mit Nachfragteil hat sich bewährt, solche Attributionen hervorzulocken. Gerade diese offene Herangehensweise in Verbindung mit attributionstheoretischen Aspekten unterscheidet diese Arbeit von anderen Untersuchungen zu Attributionstheorien. Obwohl durch die geringe Anzahl der Interviews je Gruppe nur ein kleiner Ausschnitt an Attributionen in konflikthaften und gescheiterten Partnerschaften gezeigt werden konnte, sind doch auffällige Übereinstimmungen und Unterschiede sichtbar geworden. Die Untersuchung zeigt, dass Partner die Handlungen des anderen subjektiv interpretieren entsprechend ihrem individuellen Beziehungskonzept und der eigenen sowie gemeinsamen Lern- und Lebensgeschichte. Für beide gibt es keine objektive Wahrheit, sondern nur subjektive Wirklichkeiten. Ähnlich wie Eva Wunderer (2003) den Beginn einer Liebe durch verzerrte Wahrnehmung erklärt: der oder die Geliebte werden als einmalig und allen anderen als meilenweit überlegen erlebt, obgleich die Unterschiede zum Rest der Menschheit vielleicht gar nicht so groß sind (Wunderer 2003, 32), werden möglicherweise auch konflikthafte und gescheiterte Paarsituationen verzerrt wahrgenommen, was sich in entsprechenden Attributionen niederschlägt. Die Wahrnehmung weicht auch in diesen Fällen von der Realität in eine Richtung ab, die das gegenwärtige Empfinden in der Partnerschaft verstärkt. Die Ergebnisse der Auswertung der Interviews lassen vermuten, dass konfliktbelastete Paare ungünstiger attribuieren: mehr individuelle Aspekte statt situativer Aspekte. Durch vermehrte Negativattributionen wird das negative Gefühl zum Partner aufrechterhalten. Gerade bei den Paaren, die konflikthaft zusammenleben und ihre Partnerschaft retten wollen, bietet sich ein Re-attributionsverfahren an, was auf die Veränderung von Attributionen abzielt. Hier liegt die praktische Verwertbarkeit dieser Untersuchung“

 oder komplett unterschiedliche Beratungsansätze? Eine trennscharfe Unterscheidung aufgrund theoretischer Texte ist nicht leicht. Aber was kommt heraus, wenn man (potentielle) KlientInnen vn Supervision und Coaching befragt? Diese Frage stellte sich Markus Ebner, Wirtschaftspsychologe sowie Trainer und Coach und führte eine interessante Untersuchung mit 160 Psychologie-Studierenden an der Universität Wien durch. Diese wurden aufgefordert, jeweils zwei Assoziationen zu Supervision und Coaching zu äußern und diese anschließend zu bewerten. Das interessante Ergebnis: Die Assoziationen zeigen nur einen geringen Überschneidungsbereich, nämlich„Hilfe“ und„Beratung“. Es fiel den Studenten leichter, Assoziationen zu Coaching zu generieren, die im übrigen eher entwicklungsorientiert waren, während sie Assoziationen zu Supervision stärker mit Kontrolldimensionen verbunden waren. Ebner hat seine Untersuchung auf dem bestNET.Kongress 2007 vorgestellt, sie ist auch online zu lesen,
oder komplett unterschiedliche Beratungsansätze? Eine trennscharfe Unterscheidung aufgrund theoretischer Texte ist nicht leicht. Aber was kommt heraus, wenn man (potentielle) KlientInnen vn Supervision und Coaching befragt? Diese Frage stellte sich Markus Ebner, Wirtschaftspsychologe sowie Trainer und Coach und führte eine interessante Untersuchung mit 160 Psychologie-Studierenden an der Universität Wien durch. Diese wurden aufgefordert, jeweils zwei Assoziationen zu Supervision und Coaching zu äußern und diese anschließend zu bewerten. Das interessante Ergebnis: Die Assoziationen zeigen nur einen geringen Überschneidungsbereich, nämlich„Hilfe“ und„Beratung“. Es fiel den Studenten leichter, Assoziationen zu Coaching zu generieren, die im übrigen eher entwicklungsorientiert waren, während sie Assoziationen zu Supervision stärker mit Kontrolldimensionen verbunden waren. Ebner hat seine Untersuchung auf dem bestNET.Kongress 2007 vorgestellt, sie ist auch online zu lesen,
 Heute vor 115 Jahren kam Fritz Perls in Berlin zur Welt. Am 14.5.1970 ist er in Chikago gestorben. Friedrich Salomon Perls – auch Frederick S. Perls – begann 1913 Medizin zu studieren und schloss nach dem Krieg 1921 mit einem Dr. med. ab, um dann Neuropsychiater zu werden. Anfang der 1930er Jahre machte Fritz Perls eine Lehranalyse bei Wilhelm Reich. Er wurde Psychoanalytiker, entwickelte dann aber in Abgrenzung zur Psychoanalyse mit seiner Frau Laura Perls (geb. Lore Posner), Paul Goodman und anderen Mitarbeitern das spezifische erlebnisaktivierende Psychotherapieverfahren der Gestalttherapie (Informationen: Wikipedia). In einer umfangreichen Dissertation, die Bernd Bocian 2002 an der philosophischen Fakultät der TU Berlin vorlegte, untersucht der Autor die Lebenserfahrung und Theorieproduktion Fritz Perls in Berlin von 1893 bis zu seiner Emigration 1933. Sein„Beitrag zur deutschen Vorgeschichte und zugleich zur Aktualität von Gestalttherapie und Gestaltpädagogik“ ist eine ausführliche und detaillierte Darstellung von Perls erster Lebenshälfte im politischen und wirtschaftlichen Kontext seiner Zeit, vor allem, was die Situation der Juden im Deutschen Reich betraf. In seiner Einleitung schreibt der Autor:„Zentrale Haltungen, Theorien und Methoden der Gestalttherapie beinhalten für mich wesentlich ein durch den deutschen Nationalsozialismus vertriebenes Erbe. Die oftmals fehlende Wahrnehmung dieses historischen Hintergrunds hat meiner Ansicht nach auch damit zu tun, daß innerhalb der Gestalttherapie hierzulande eine weitreichende Amnesie in Bezug auf die deutsche Vorgeschichte unseres Ansatzes existiert. Dies macht auch den gestalttherapeutischen Anteil an der deutschen Amnesie in Bezug auf die angesprochene Zeit aus. Was mit Fritz Perls 1933 aus Deutschland geflohen ist und was Deutschland verlorenging, sind im Kern die Erfahrungen der sogenannten expressionistischen Generation. Diese gesellschaftlichen Außenseiter und Pioniere der Moderne erlebten und erlitten den sich in Deutschland und speziell in der Metropole Berlin rasant durchsetzenden Modernisierungsprozess am bewußtesten. Auf vorgeschobenem Posten versuchten sie mit dem umzugehen, was von aktuellen Zeitdiagnostikern (z. B. Zygmunt Baumann, Ulrich Beck, Heiner Keupp) als Chance und Gefahr für die Identitätsbildung der Menschen in den heutigen Industrienationen benannt wird. Gemeint sind hier etwa Diagnosen wie Pluralität der Weltdeutungen und Sinngebungen und die Auflösung der traditionellen Einbindungen mit Druck und Möglichkeit zur individuellen Lebensgestaltung bzw. Selbstkonstruktion. Damals betraf dies eine kleine Gruppe, eben die Avantgarde. Heute stellen sich anscheinend diese riskanten Freiheiten (Beck) einem wachsenden Teil der Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund stellt sich für mich der Entwurf der Gestalttherapie als ein Antwortversuch konkreter Subjekte auf die Bedrohungen und Chancen eines Prozesses sozialpsychologischer Veränderungen dar, der andauert und seitdem immer größere Teile der Gesellschaft erfaßt hat. Perls ist mit einer Sozialisationsgeschichte in die Emigration gegangen, die er mit der damaligen Großstadtavantgarde teilte“ Das ganze ist ungemein spannend zu lesen und ein schönes Beispiel für eine Psychotherapiegeschichte, die ihre gesellschaftlichen Umstände nicht aus dem Blick verliert.
Heute vor 115 Jahren kam Fritz Perls in Berlin zur Welt. Am 14.5.1970 ist er in Chikago gestorben. Friedrich Salomon Perls – auch Frederick S. Perls – begann 1913 Medizin zu studieren und schloss nach dem Krieg 1921 mit einem Dr. med. ab, um dann Neuropsychiater zu werden. Anfang der 1930er Jahre machte Fritz Perls eine Lehranalyse bei Wilhelm Reich. Er wurde Psychoanalytiker, entwickelte dann aber in Abgrenzung zur Psychoanalyse mit seiner Frau Laura Perls (geb. Lore Posner), Paul Goodman und anderen Mitarbeitern das spezifische erlebnisaktivierende Psychotherapieverfahren der Gestalttherapie (Informationen: Wikipedia). In einer umfangreichen Dissertation, die Bernd Bocian 2002 an der philosophischen Fakultät der TU Berlin vorlegte, untersucht der Autor die Lebenserfahrung und Theorieproduktion Fritz Perls in Berlin von 1893 bis zu seiner Emigration 1933. Sein„Beitrag zur deutschen Vorgeschichte und zugleich zur Aktualität von Gestalttherapie und Gestaltpädagogik“ ist eine ausführliche und detaillierte Darstellung von Perls erster Lebenshälfte im politischen und wirtschaftlichen Kontext seiner Zeit, vor allem, was die Situation der Juden im Deutschen Reich betraf. In seiner Einleitung schreibt der Autor:„Zentrale Haltungen, Theorien und Methoden der Gestalttherapie beinhalten für mich wesentlich ein durch den deutschen Nationalsozialismus vertriebenes Erbe. Die oftmals fehlende Wahrnehmung dieses historischen Hintergrunds hat meiner Ansicht nach auch damit zu tun, daß innerhalb der Gestalttherapie hierzulande eine weitreichende Amnesie in Bezug auf die deutsche Vorgeschichte unseres Ansatzes existiert. Dies macht auch den gestalttherapeutischen Anteil an der deutschen Amnesie in Bezug auf die angesprochene Zeit aus. Was mit Fritz Perls 1933 aus Deutschland geflohen ist und was Deutschland verlorenging, sind im Kern die Erfahrungen der sogenannten expressionistischen Generation. Diese gesellschaftlichen Außenseiter und Pioniere der Moderne erlebten und erlitten den sich in Deutschland und speziell in der Metropole Berlin rasant durchsetzenden Modernisierungsprozess am bewußtesten. Auf vorgeschobenem Posten versuchten sie mit dem umzugehen, was von aktuellen Zeitdiagnostikern (z. B. Zygmunt Baumann, Ulrich Beck, Heiner Keupp) als Chance und Gefahr für die Identitätsbildung der Menschen in den heutigen Industrienationen benannt wird. Gemeint sind hier etwa Diagnosen wie Pluralität der Weltdeutungen und Sinngebungen und die Auflösung der traditionellen Einbindungen mit Druck und Möglichkeit zur individuellen Lebensgestaltung bzw. Selbstkonstruktion. Damals betraf dies eine kleine Gruppe, eben die Avantgarde. Heute stellen sich anscheinend diese riskanten Freiheiten (Beck) einem wachsenden Teil der Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund stellt sich für mich der Entwurf der Gestalttherapie als ein Antwortversuch konkreter Subjekte auf die Bedrohungen und Chancen eines Prozesses sozialpsychologischer Veränderungen dar, der andauert und seitdem immer größere Teile der Gesellschaft erfaßt hat. Perls ist mit einer Sozialisationsgeschichte in die Emigration gegangen, die er mit der damaligen Großstadtavantgarde teilte“ Das ganze ist ungemein spannend zu lesen und ein schönes Beispiel für eine Psychotherapiegeschichte, die ihre gesellschaftlichen Umstände nicht aus dem Blick verliert.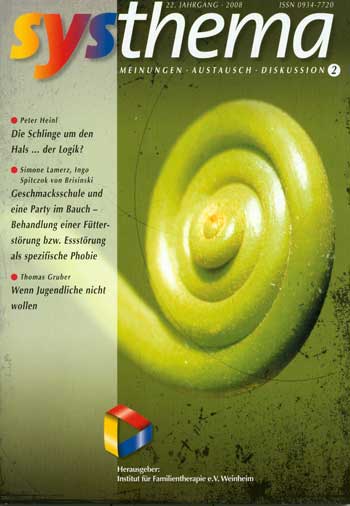

 „Morus Markard ist der letzte Professor, der an der Freien Universität (FU) Berlin Lehrveranstaltungen zur Kritischen Psychologie anbietet und auch das nur per Lehrauftrag, der jedes Semester neu vergeben werden muss. Damit sollte nun nach dem Willen der FU Schluss sein. Begründung: Die FU müsse sich auf die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge vorbereiten. Durch eine Protestaktion konnten die Studierenden dafür sorgen, dass Markard den Lehrauftrag noch mal bekam“ So war im Februar 2007 auf der website keimform.de zu lesen. Schaut man auf der Uni-website nach, stellt man fest, dass Markard als außerplanmäßiger Professor im Arbeitsbereich Subjektforschung und Kritische Psychologie noch immer Lehrveranstaltungen anbietet. Auf der therapieschulenübergreifende Tagung„Das Unbehagen in der (Psychotherapie-)Kultur. Sinnverstehende Traditionen – Grundlagen und Perspektiven“, die am 17. und 18. März 2006 in Bonn stattfand, stellte Markard seine„subjektwissenschaftlichen Überlegungen zum Verhältnis von subjektiver Erfahrung und wissenschaftlicher Verallgemeinerung“ vor, die in einer überarbeiteten und erweiterten Fassung im Online-„Journal für Psychologie“ 3/2007 nachzulesen sind. In dieser unbedingt lesenswerten Arbeit geht es um das Verhältnis von Begriffen und Erfahrung, um die Mitteilbarkeit von Erfahrung, über das Verhältnis von Theorie und Praxis und die Folgerungen für das Denken über Therapie, das sich nicht dem nomothetischen Ursache-Wirkungs-Paradigma der Mainstream-Psychologie unterwirft:„Die Gesellschaft ist zwar ein reales System, durch das die Lebenserhaltung des einzelnen vermittelt ist; Gesellschaft als System ist aber für sich genommen kein anschaulicher, kein unmittelbarer Erfahrungstatbestand. Gesellschaftliche Verhältnisse strukturieren, vermittelt über verschiedene auch i.e.S. institutionelle Subsysteme, die Lebenstätigkeiten, Denkweisen und Erfahrungen der Gesellschaftsmitglieder. Diese Strukturiertheit ist selber aber nicht anschaulich, sondern nur, wenn man so will, rekonstruktiv zu ermitteln. Was (jeweils) zu rekonstruieren ist, ist der Vermittlungszusammenhang zwischen unmittelbarer Lebenswelt bzw. unmittelbar gegebener Situation und dem diese umgreifenden und strukturierenden gesellschaftlichen System. In unserem Zusammenhang zentral ist, dass das gesellschaftliche System und seine institutionellen Subsysteme auch die unmittelbaren und in ihrer lebensweltlichen Unmittelbarkeit durchaus auch anschaulich anmutenden sozialen Beziehungen unanschaulich strukturieren. Anschauliche soziale Beziehungen gehen in ihrer Anschaulichkeit nicht auf. Wie wir Männer, Frauen, Kinder wahrnehmen, hat biographische, situative und gesellschaftliche Dimensionen. Die Unanschaulichkeit von gesellschaftlichen Strukturen bedeutet eben keineswegs ihre Unerfahrbarkeit, sondern nur, dass Erfahrungen, sofern sie nicht auf diese Momente hin analysiert werden, unvollständig und schief analysiert werden. Wir müssen allerdings bedenken, dass es bezüglich dessen, was Gesellschaft ist, in welcher Art Gesellschaft wir leben, unterschiedliche, konkurrierende theoretische Rekonstruktionen und Reflexionen gibt. Daraus folgt, dass die Aufschlüsselung von Erfahrungen strittig sein muss. Ob man diese Gesellschaft als soziale Marktwirtschaft, als Risikogesellschaft, als Ambiente postmoderner Flaneure oder als ordinäre kapitalistische Barbarei betrachtet, ist umstritten, aber für die Aufschlüsselung von Erfahrung (bspw. von Arbeitslosigkeit oder Schulschwänzen) wesentlich, je nach Lage der Dinge auch praktisch relevant“
„Morus Markard ist der letzte Professor, der an der Freien Universität (FU) Berlin Lehrveranstaltungen zur Kritischen Psychologie anbietet und auch das nur per Lehrauftrag, der jedes Semester neu vergeben werden muss. Damit sollte nun nach dem Willen der FU Schluss sein. Begründung: Die FU müsse sich auf die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge vorbereiten. Durch eine Protestaktion konnten die Studierenden dafür sorgen, dass Markard den Lehrauftrag noch mal bekam“ So war im Februar 2007 auf der website keimform.de zu lesen. Schaut man auf der Uni-website nach, stellt man fest, dass Markard als außerplanmäßiger Professor im Arbeitsbereich Subjektforschung und Kritische Psychologie noch immer Lehrveranstaltungen anbietet. Auf der therapieschulenübergreifende Tagung„Das Unbehagen in der (Psychotherapie-)Kultur. Sinnverstehende Traditionen – Grundlagen und Perspektiven“, die am 17. und 18. März 2006 in Bonn stattfand, stellte Markard seine„subjektwissenschaftlichen Überlegungen zum Verhältnis von subjektiver Erfahrung und wissenschaftlicher Verallgemeinerung“ vor, die in einer überarbeiteten und erweiterten Fassung im Online-„Journal für Psychologie“ 3/2007 nachzulesen sind. In dieser unbedingt lesenswerten Arbeit geht es um das Verhältnis von Begriffen und Erfahrung, um die Mitteilbarkeit von Erfahrung, über das Verhältnis von Theorie und Praxis und die Folgerungen für das Denken über Therapie, das sich nicht dem nomothetischen Ursache-Wirkungs-Paradigma der Mainstream-Psychologie unterwirft:„Die Gesellschaft ist zwar ein reales System, durch das die Lebenserhaltung des einzelnen vermittelt ist; Gesellschaft als System ist aber für sich genommen kein anschaulicher, kein unmittelbarer Erfahrungstatbestand. Gesellschaftliche Verhältnisse strukturieren, vermittelt über verschiedene auch i.e.S. institutionelle Subsysteme, die Lebenstätigkeiten, Denkweisen und Erfahrungen der Gesellschaftsmitglieder. Diese Strukturiertheit ist selber aber nicht anschaulich, sondern nur, wenn man so will, rekonstruktiv zu ermitteln. Was (jeweils) zu rekonstruieren ist, ist der Vermittlungszusammenhang zwischen unmittelbarer Lebenswelt bzw. unmittelbar gegebener Situation und dem diese umgreifenden und strukturierenden gesellschaftlichen System. In unserem Zusammenhang zentral ist, dass das gesellschaftliche System und seine institutionellen Subsysteme auch die unmittelbaren und in ihrer lebensweltlichen Unmittelbarkeit durchaus auch anschaulich anmutenden sozialen Beziehungen unanschaulich strukturieren. Anschauliche soziale Beziehungen gehen in ihrer Anschaulichkeit nicht auf. Wie wir Männer, Frauen, Kinder wahrnehmen, hat biographische, situative und gesellschaftliche Dimensionen. Die Unanschaulichkeit von gesellschaftlichen Strukturen bedeutet eben keineswegs ihre Unerfahrbarkeit, sondern nur, dass Erfahrungen, sofern sie nicht auf diese Momente hin analysiert werden, unvollständig und schief analysiert werden. Wir müssen allerdings bedenken, dass es bezüglich dessen, was Gesellschaft ist, in welcher Art Gesellschaft wir leben, unterschiedliche, konkurrierende theoretische Rekonstruktionen und Reflexionen gibt. Daraus folgt, dass die Aufschlüsselung von Erfahrungen strittig sein muss. Ob man diese Gesellschaft als soziale Marktwirtschaft, als Risikogesellschaft, als Ambiente postmoderner Flaneure oder als ordinäre kapitalistische Barbarei betrachtet, ist umstritten, aber für die Aufschlüsselung von Erfahrung (bspw. von Arbeitslosigkeit oder Schulschwänzen) wesentlich, je nach Lage der Dinge auch praktisch relevant“
 „Eine sehr alte, frühgriechische Tradition schweißt den Komplex Gefühl zusammen mit der Beobachtung von Körperzuständen. An Körpern zeigen sich Gefühle, nur so kann man sie an anderen Leuten sehen, und Gefühle überfallen und unterwerfen den Menschen, der im Grunde nur zuschauen, nur erleben kann, wie er überwältigt wird. Diese Sichtweise, die phänomenologisch überzeugen könnte, wird in der ersten griechischen Aufklärung aus Gründen, die sich hier nicht erörtern lassen, massiv verändert. Das Gefühl wird dem Seeleninnenraum zugeschlagen in mehr und mehr scharf ausgeprägter Differenz zum Körper. Es ist unkörperlich, fluidal und in Fortführung dieser Seelensemantik energetisch als dasjenige, was der Seele entspringt oder worin die Seele sich regt. Es ist in interiore hominis, im Innern des Menschen angesiedelt, eine Binnenvitalität, die das Pneumatische der Kognitionen an das Leben anschließt. Diese Vorstellung hält sich Jahrtausende durch und erstreckt sich in raffinierten, wenn auch zunehmend ausdünnenden Verästelungen bis in die Gegenwart hinein als eine Körperverdeckungsstrategie, die die Annahme, Gefühl sei etwa (nur!) die sozial konditionierte Registratur von Körperzuständen, als Absurdität erscheinen läßt
“ So beginnt ein spannender Aufsatz von Peter Fuchs aus dem Heft 1/2004 von„Soziale Systeme“, das dem Thema Systemtheorie und Gefühle gewidmet ist. Die Einleitung zu diesem Heft von Dirk Baecker„
„Eine sehr alte, frühgriechische Tradition schweißt den Komplex Gefühl zusammen mit der Beobachtung von Körperzuständen. An Körpern zeigen sich Gefühle, nur so kann man sie an anderen Leuten sehen, und Gefühle überfallen und unterwerfen den Menschen, der im Grunde nur zuschauen, nur erleben kann, wie er überwältigt wird. Diese Sichtweise, die phänomenologisch überzeugen könnte, wird in der ersten griechischen Aufklärung aus Gründen, die sich hier nicht erörtern lassen, massiv verändert. Das Gefühl wird dem Seeleninnenraum zugeschlagen in mehr und mehr scharf ausgeprägter Differenz zum Körper. Es ist unkörperlich, fluidal und in Fortführung dieser Seelensemantik energetisch als dasjenige, was der Seele entspringt oder worin die Seele sich regt. Es ist in interiore hominis, im Innern des Menschen angesiedelt, eine Binnenvitalität, die das Pneumatische der Kognitionen an das Leben anschließt. Diese Vorstellung hält sich Jahrtausende durch und erstreckt sich in raffinierten, wenn auch zunehmend ausdünnenden Verästelungen bis in die Gegenwart hinein als eine Körperverdeckungsstrategie, die die Annahme, Gefühl sei etwa (nur!) die sozial konditionierte Registratur von Körperzuständen, als Absurdität erscheinen läßt
“ So beginnt ein spannender Aufsatz von Peter Fuchs aus dem Heft 1/2004 von„Soziale Systeme“, das dem Thema Systemtheorie und Gefühle gewidmet ist. Die Einleitung zu diesem Heft von Dirk Baecker„