 Gerade war ich für einige Zeit im Ausland und habe dadurch die Irritationen auf dem Finanzmarkt nur mit zeitlichem Abstand und Distanz zur deutschen Nachrichtenaufbereitung beobachten können. Da kann man sich nur wundern, wie Hochrisikogeschäfte mancher Bankmanager unterschiedlicher Banken (wer weiß, wie viele es noch werden?) durch staatliche Interventionen abgesichert und gestützt werden müssen. Es ist zu befürchten, dass es letztlich nur eine Frage der Zeit ist, bis eine Umschichtung von Steuergeldern, die für soziale Aufgaben benötigt werden, zugunsten einer Verwendung für notleidende Banken erfolgen wird (Früher, wenn ich mich recht erinnere, wurde mit dem Adjektiv notleidend Spendenaufrufe getätigt, deren Erlös wilden Tieren, die für ihr Schicksal nun wirklich nichts konnten, z.B. in der Serengeti, zu helfen). In einem Bereich sozialer Arbeit lässt sich diese Einsparwut schon seit längerer Zeit beobachten: In der öffentlichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Da wurden in der Vergangenheit manche Umstrukturierungen zwar pädagogisch begründet – letztlich dienten sie jedoch oftmals Sparzwecken bzw. immer enger werdender Budgets. Und genau in dieser angespannten Finanzkrise, deren Folgen nicht annähernd absehbar sind, erscheint ein Buch in 3. Auflage, das sich dem Thema der Arbeit in der öffentlichen Jugendhilfe widmet. Es handelt sich um das Buch Familien WACH begleiten von Friedhelm Kron-Klees. Der Autor hat das Buch gründlich überarbeitet und es sowohl um theoretische Überlegungen als auch praktisch Empfehlungen erweitert. Kron-Klees reflektiert darin, ob und wie aus einer systemisch-konstruktivistischen Erkenntniskritik heraus ein konsequent hilfeorientiertes Wahrnehmungs- und Handlungskonzept der Jugendamts-Aufgaben formuliert werden kann. Mein Konzept des wachen Begleitens als Aufgabe sozialer Arbeit im Jugendamts-Kontext wird hierbei als Alternative zu herkömmlichen Kontrollvorstellungen in den Mittelpunkt gerückt. (S. 159).
Gerade war ich für einige Zeit im Ausland und habe dadurch die Irritationen auf dem Finanzmarkt nur mit zeitlichem Abstand und Distanz zur deutschen Nachrichtenaufbereitung beobachten können. Da kann man sich nur wundern, wie Hochrisikogeschäfte mancher Bankmanager unterschiedlicher Banken (wer weiß, wie viele es noch werden?) durch staatliche Interventionen abgesichert und gestützt werden müssen. Es ist zu befürchten, dass es letztlich nur eine Frage der Zeit ist, bis eine Umschichtung von Steuergeldern, die für soziale Aufgaben benötigt werden, zugunsten einer Verwendung für notleidende Banken erfolgen wird (Früher, wenn ich mich recht erinnere, wurde mit dem Adjektiv notleidend Spendenaufrufe getätigt, deren Erlös wilden Tieren, die für ihr Schicksal nun wirklich nichts konnten, z.B. in der Serengeti, zu helfen). In einem Bereich sozialer Arbeit lässt sich diese Einsparwut schon seit längerer Zeit beobachten: In der öffentlichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Da wurden in der Vergangenheit manche Umstrukturierungen zwar pädagogisch begründet – letztlich dienten sie jedoch oftmals Sparzwecken bzw. immer enger werdender Budgets. Und genau in dieser angespannten Finanzkrise, deren Folgen nicht annähernd absehbar sind, erscheint ein Buch in 3. Auflage, das sich dem Thema der Arbeit in der öffentlichen Jugendhilfe widmet. Es handelt sich um das Buch Familien WACH begleiten von Friedhelm Kron-Klees. Der Autor hat das Buch gründlich überarbeitet und es sowohl um theoretische Überlegungen als auch praktisch Empfehlungen erweitert. Kron-Klees reflektiert darin, ob und wie aus einer systemisch-konstruktivistischen Erkenntniskritik heraus ein konsequent hilfeorientiertes Wahrnehmungs- und Handlungskonzept der Jugendamts-Aufgaben formuliert werden kann. Mein Konzept des wachen Begleitens als Aufgabe sozialer Arbeit im Jugendamts-Kontext wird hierbei als Alternative zu herkömmlichen Kontrollvorstellungen in den Mittelpunkt gerückt. (S. 159).
Zur Rezension
19. Oktober 2008
von Klein
Keine Kommentare

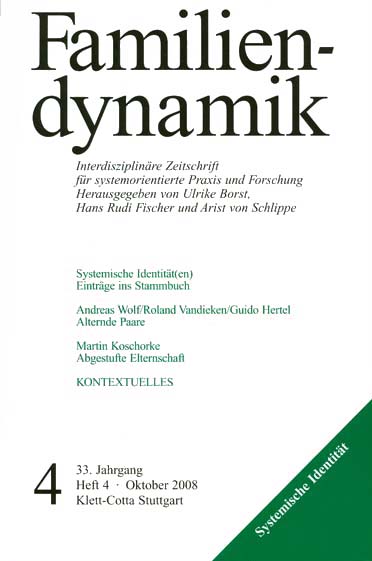

 Manfred Füllsack, Sozialwissenschaftler an der Universität Wien, hat sich 1998, also nach Erscheinen von Luhmanns„Gesellschaft der Gesellschaft“ in einem Aufsatz für„Soziale Systeme“ (mit dem Titel„Geltungsansprüche und Beobachtungen zweiter Ordnung. Wie nahe kommen sich Diskurs- und Systemtheorie?“) noch einmal Gedanken über die sogenannte Habermas-Luhmann-Debatte unter gemacht und plädiert für eine Entpolarisierung:„Obwohl die Heftigkeit der Kontroverse nicht zuletzt auch in der Wahl der sprachlichen Mittel zwar nun eine gewisse Konsolidierung gegenüber ihrem Beginn in den siebziger Jahren zu erfahren scheint, dürften die beiden Konzepte in der sozialwissenschaftlichen Theoriediskussion nach wie vor als weitgehend inkompatibel gelten. Gerade Die Gesellschaft der Gesellschaft gibt aber, indem sie gewisse, freilich bereits auch im früheren Werk angelegte Züge der systemtheoretischen Konzeption mit neuer Deutlichkeit herausstellt, Anlaß, einen zweiten Blick auf Parallelen und Analogien von Diskurs- und Systemtheorie zu werfen. Dabei zeigt sich überraschender Weise, daß die Fronten so starr gar nicht sein müßten, daß sie vielmehr an sehr grundsätzlichen Stellen Möglichkeiten bieten, um die eine Konzeption in die andere überzuführen oder mit den Konsequenzen der einen an Prämissen der anderen gewissermaßen interkonzeptuell anzuschließen. Ob die beiden Autoren (und vor allem die mittlerweile nicht unbeträchtliche Zahl ihrer Epigonen) ihre Theorien freilich in dieser Weise kompatibilisiert sehen wollten, bleibt fraglich. Da sich aber beim Aneinanderhalten der beiden Konzepte einerseits ein besseres Verständnis der jeweiligen Ansätze ergeben könnte ( – um mit Luhmann zu sprechen, kann man dann sehen, daß und wie eine der Theorien sehen kann, was die jeweils andere nicht sehen kann – ), und andererseits damit vielleicht auch weitere Anschlußmöglichkeiten für die Sozialwissenschaften geschaffen werden, werde ich im folgenden als Teil einer umfangreicheren Untersuchungsreihe zur Habermas-Luhmann-Debatte – die jeweiligen theoretischen Zentren der beiden Konzeptionen gegeneinanderstellen und zeigen, daß ihre Differenzen zwar grundsätzlich, nicht aber unüberwindbar sind“ Der Aufsatz ist auch im Internet zu lesen,
Manfred Füllsack, Sozialwissenschaftler an der Universität Wien, hat sich 1998, also nach Erscheinen von Luhmanns„Gesellschaft der Gesellschaft“ in einem Aufsatz für„Soziale Systeme“ (mit dem Titel„Geltungsansprüche und Beobachtungen zweiter Ordnung. Wie nahe kommen sich Diskurs- und Systemtheorie?“) noch einmal Gedanken über die sogenannte Habermas-Luhmann-Debatte unter gemacht und plädiert für eine Entpolarisierung:„Obwohl die Heftigkeit der Kontroverse nicht zuletzt auch in der Wahl der sprachlichen Mittel zwar nun eine gewisse Konsolidierung gegenüber ihrem Beginn in den siebziger Jahren zu erfahren scheint, dürften die beiden Konzepte in der sozialwissenschaftlichen Theoriediskussion nach wie vor als weitgehend inkompatibel gelten. Gerade Die Gesellschaft der Gesellschaft gibt aber, indem sie gewisse, freilich bereits auch im früheren Werk angelegte Züge der systemtheoretischen Konzeption mit neuer Deutlichkeit herausstellt, Anlaß, einen zweiten Blick auf Parallelen und Analogien von Diskurs- und Systemtheorie zu werfen. Dabei zeigt sich überraschender Weise, daß die Fronten so starr gar nicht sein müßten, daß sie vielmehr an sehr grundsätzlichen Stellen Möglichkeiten bieten, um die eine Konzeption in die andere überzuführen oder mit den Konsequenzen der einen an Prämissen der anderen gewissermaßen interkonzeptuell anzuschließen. Ob die beiden Autoren (und vor allem die mittlerweile nicht unbeträchtliche Zahl ihrer Epigonen) ihre Theorien freilich in dieser Weise kompatibilisiert sehen wollten, bleibt fraglich. Da sich aber beim Aneinanderhalten der beiden Konzepte einerseits ein besseres Verständnis der jeweiligen Ansätze ergeben könnte ( – um mit Luhmann zu sprechen, kann man dann sehen, daß und wie eine der Theorien sehen kann, was die jeweils andere nicht sehen kann – ), und andererseits damit vielleicht auch weitere Anschlußmöglichkeiten für die Sozialwissenschaften geschaffen werden, werde ich im folgenden als Teil einer umfangreicheren Untersuchungsreihe zur Habermas-Luhmann-Debatte – die jeweiligen theoretischen Zentren der beiden Konzeptionen gegeneinanderstellen und zeigen, daß ihre Differenzen zwar grundsätzlich, nicht aber unüberwindbar sind“ Der Aufsatz ist auch im Internet zu lesen, Wie sich mittlerweile herumgesprochen hat, sind in keinem Land der Welt mehr Menschen inhaftiert (in Relation zur Gesamtbevölkerung) wie in den USA. Ein Thema für Psychotherapeuten? Bislang wohl viel zu wenig. Die aktuelle Ausgabe von„Family Process“ ist diesem Schwerpunkt gewidmet. In einem leidenschaftlichen Plädoyer, sich intensiver mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, nennt Herausgeberin Evan Imber-Black ein paar Zahlen: Alleine im Jahre 2007 nahm die Zahl der Gefängnisinsassen in den USA um 25.000 zu! Mehr als einer von hundert Amerikanern ist inhaftiert, aber genauer: einer von 36 Latinos, einer von 15 schwarzen Männern, 1 von 9 schwarzen Jugendlichen! Die durchschnittlichen Kosten eines Gefängnisjahres pro Person belaufen sich auf 23.000 $, ein Betrag, von dem die Unterrichtskosten vieler Colleges bestritten werden könnten. Der Bundesstaat Arizona gibt mehr Geld für die Haftunterbringung von Latinos und Afroamerikanern aus als insgesamt für ihre Bildung. usw. usw. Die Beiträge des aktuellen Heftes befassen sich schwerpunktmäßig mit inhaftierten Frauen und Müttern und könnten auch als Anregung verstanden werden, sich auch hierzulande stärker mit dem Thema des Strafvollzuges aus psychosozialer und therapeutisch-pädagogischer Sicht auseinanderzusetzen.
Wie sich mittlerweile herumgesprochen hat, sind in keinem Land der Welt mehr Menschen inhaftiert (in Relation zur Gesamtbevölkerung) wie in den USA. Ein Thema für Psychotherapeuten? Bislang wohl viel zu wenig. Die aktuelle Ausgabe von„Family Process“ ist diesem Schwerpunkt gewidmet. In einem leidenschaftlichen Plädoyer, sich intensiver mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, nennt Herausgeberin Evan Imber-Black ein paar Zahlen: Alleine im Jahre 2007 nahm die Zahl der Gefängnisinsassen in den USA um 25.000 zu! Mehr als einer von hundert Amerikanern ist inhaftiert, aber genauer: einer von 36 Latinos, einer von 15 schwarzen Männern, 1 von 9 schwarzen Jugendlichen! Die durchschnittlichen Kosten eines Gefängnisjahres pro Person belaufen sich auf 23.000 $, ein Betrag, von dem die Unterrichtskosten vieler Colleges bestritten werden könnten. Der Bundesstaat Arizona gibt mehr Geld für die Haftunterbringung von Latinos und Afroamerikanern aus als insgesamt für ihre Bildung. usw. usw. Die Beiträge des aktuellen Heftes befassen sich schwerpunktmäßig mit inhaftierten Frauen und Müttern und könnten auch als Anregung verstanden werden, sich auch hierzulande stärker mit dem Thema des Strafvollzuges aus psychosozialer und therapeutisch-pädagogischer Sicht auseinanderzusetzen. Während sich die Politik darauf geeinigt hat, die Bezüge von Bankmanagern deutlich zu begrenzen, fordern Wirtschaftswissenschaftler der TU Chemnitz, dass Bankvorstände zukünftig mit einem monatlichen Regelsatz von 132 Euro auskommen sollen. Das geht aus einer Studie hervor, die am Mittwoch auf der Internetseite der Technischen Universität Chemnitz veröffentlicht wurde. Für alle Bereiche des Lebens, ob Ernährung, Kommunikation oder Kultur, sehen die Wissenschaftler bei dieser Personengruppe erhebliches Kürzungspotenzial.„Die Durchschnittsbezüge von Bankvorständen liegen bei 12 Millionen . Wir haben festgestellt, dass man zum Leben aber nur 132 im Monat braucht“, sagte der Leiter der Studie, Friedrich Thießen dem systemagazin. BDI-Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf verurteilte die Studie dagegen als„hochgradig interessengeleitet“. Die Umsetzung des Vorschlags würde die ohnehin zu hohe Belastung für die Leistungsträger der Finanzwirtschaft massiv verschärfen, betonte er. Die Studie platzt mitten in eine neue, heftig geführte Debatte über Zahlungen an Bankmanager in Zeiten der Finanzkrise. In den Reihen der SPD mehren sich die Stimmen, die für mehr Härte bei missbräuchlichem Bezug von Vorstandsgehältern plädieren. CDU und CSU hingegen sprechen sich eher dafür aus, den Vorständen wenigstens Gehälter in Höhe der aktuellen Hartz-IV-Sätze von 350 zuzubilligen. Nach Ansicht der Chemnitzer Ökonomen ist es rechtlich völlig unklar, was unter Existenzminimum zu verstehen ist.„Unsere Gesellschaft hat sich bisher davor herumgedrückt, die Ziele der Mindestsicherung für Bankmanager exakt zu formulieren“, heißt es in der Studie. Aus dem Grundgesetz ließen sich lediglich schwammige Leitbilder der„physischen Existenzsicherung“ und der„Teilhabe am kulturellen Leben“ ableiten. Dafür reichten aber weitaus geringere Leistungen: Der derzeitige Hartz-IV-Satz liege jedenfalls„weit oberhalb des physischen Existenzminimums“. In einer Tabelle erstellen die Autoren deshalb für alle relevanten Lebensbereiche Richtwerte, die ihrer Meinung nach angemessen sind. Die Preiserhebungen wurden ausschließlich in Discountern und Billig-Ketten durchgeführt. So reiche ein Euro, um den monatlichen Freizeit- und Unterhaltungsbedarf von Bankvorständen zu decken. Mit zwei Euro für„20 Min./Tag Internet in Stadtbibliothek“ ließe sich ausreichend kommunizieren. Der Bedarf für Lebensmittel wird auf 68 Euro monatlich taxiert. Auf Champagner und Zigarren müsse verzichtet werden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann zeigte sich entsetzt. Er warf den Autoren vor, die sich ausbreitende Manager-Armut mit Theoriespielchen zu verschleiern.„Nicht einmal der laufende Schulbedarf für Kinder ist gedeckt“, so Ackermann.„Der Regelsatz enthält lediglich 1,63 Euro für allgemeine Schreibwaren“
Während sich die Politik darauf geeinigt hat, die Bezüge von Bankmanagern deutlich zu begrenzen, fordern Wirtschaftswissenschaftler der TU Chemnitz, dass Bankvorstände zukünftig mit einem monatlichen Regelsatz von 132 Euro auskommen sollen. Das geht aus einer Studie hervor, die am Mittwoch auf der Internetseite der Technischen Universität Chemnitz veröffentlicht wurde. Für alle Bereiche des Lebens, ob Ernährung, Kommunikation oder Kultur, sehen die Wissenschaftler bei dieser Personengruppe erhebliches Kürzungspotenzial.„Die Durchschnittsbezüge von Bankvorständen liegen bei 12 Millionen . Wir haben festgestellt, dass man zum Leben aber nur 132 im Monat braucht“, sagte der Leiter der Studie, Friedrich Thießen dem systemagazin. BDI-Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf verurteilte die Studie dagegen als„hochgradig interessengeleitet“. Die Umsetzung des Vorschlags würde die ohnehin zu hohe Belastung für die Leistungsträger der Finanzwirtschaft massiv verschärfen, betonte er. Die Studie platzt mitten in eine neue, heftig geführte Debatte über Zahlungen an Bankmanager in Zeiten der Finanzkrise. In den Reihen der SPD mehren sich die Stimmen, die für mehr Härte bei missbräuchlichem Bezug von Vorstandsgehältern plädieren. CDU und CSU hingegen sprechen sich eher dafür aus, den Vorständen wenigstens Gehälter in Höhe der aktuellen Hartz-IV-Sätze von 350 zuzubilligen. Nach Ansicht der Chemnitzer Ökonomen ist es rechtlich völlig unklar, was unter Existenzminimum zu verstehen ist.„Unsere Gesellschaft hat sich bisher davor herumgedrückt, die Ziele der Mindestsicherung für Bankmanager exakt zu formulieren“, heißt es in der Studie. Aus dem Grundgesetz ließen sich lediglich schwammige Leitbilder der„physischen Existenzsicherung“ und der„Teilhabe am kulturellen Leben“ ableiten. Dafür reichten aber weitaus geringere Leistungen: Der derzeitige Hartz-IV-Satz liege jedenfalls„weit oberhalb des physischen Existenzminimums“. In einer Tabelle erstellen die Autoren deshalb für alle relevanten Lebensbereiche Richtwerte, die ihrer Meinung nach angemessen sind. Die Preiserhebungen wurden ausschließlich in Discountern und Billig-Ketten durchgeführt. So reiche ein Euro, um den monatlichen Freizeit- und Unterhaltungsbedarf von Bankvorständen zu decken. Mit zwei Euro für„20 Min./Tag Internet in Stadtbibliothek“ ließe sich ausreichend kommunizieren. Der Bedarf für Lebensmittel wird auf 68 Euro monatlich taxiert. Auf Champagner und Zigarren müsse verzichtet werden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann zeigte sich entsetzt. Er warf den Autoren vor, die sich ausbreitende Manager-Armut mit Theoriespielchen zu verschleiern.„Nicht einmal der laufende Schulbedarf für Kinder ist gedeckt“, so Ackermann.„Der Regelsatz enthält lediglich 1,63 Euro für allgemeine Schreibwaren“

 „Amerikamüde ist jemand, der seine Zeit als Amerikabetrachter für beendet erklärt und doch immer wieder auf dieses Land schauen muss wie Frau Matzerath auf die Aale im Pferdeschädel. Er hält das Interesse an Wahlkämpfen für übertrieben, weil es ja nicht der Präsident ist, der die USA regiert. Trotzdem geht ihm das Spektakel nicht aus dem Kopf“ So leitet Gert Raeithel seine Betrachtungen in der aktuellen Ausgabe der
„Amerikamüde ist jemand, der seine Zeit als Amerikabetrachter für beendet erklärt und doch immer wieder auf dieses Land schauen muss wie Frau Matzerath auf die Aale im Pferdeschädel. Er hält das Interesse an Wahlkämpfen für übertrieben, weil es ja nicht der Präsident ist, der die USA regiert. Trotzdem geht ihm das Spektakel nicht aus dem Kopf“ So leitet Gert Raeithel seine Betrachtungen in der aktuellen Ausgabe der  „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, so lautet der berühmte letzte Satz des Tractatus logico-philosophicus von Ludwig Wittgenstein. Franz Hogel, Dipl.-Kommunikationsdesigner und Wittgenstein-Kenner aus Nürnberg, versucht in seinem Text, die philosophischen Paradoxien Wittgensteins, die sich aus der Selbstreferentialität seines sprachlichen Philosophierens ergeben, systemtheoretisch zu rekonstruieren und mit einen systemtheoretischen Konzept von Selbstreferentialität in Beziehung zu setzen.„Die Systemtheorie transformiert den wittgensteinschen Grundsatz, dass nicht gesagt werden könne, was sich nur zeigt, dahingehend, dass nicht zugleich gesagt werden kann, was sich zeigt. In einem nächsten Satz kann sehr wohl beschrieben (gesagt) werden, was der vorangegangene gezeigt hat. Die Sage des gegenwärtigen Satzes kann sich im Moment des Sagens wiederum nur zeigen usw. Hier kann man unschwer das Motiv der Beobachtung zweiter Ordnung, die immer auch für einen Beobachter dieser Beobachtung als Beobachtung erster Ordnung beschrieben werden kann, wiedererkennen. Oder, angelehnt an Spencer-Brown: Jede Markierung von etwas setzt eine Unterscheidung ein, die nicht zugleich, sondern erst später markiert werden kann. Was sich im Gesagten gezeigt haben mag der implizite Kontext, die ausgeblendete Unterscheidung, das unwritten cross (Spencer-Brown) , kann immer nur im Nachtrag gesagt werden. Dann stellt der Beobachter der Form fest, dass er schon immer mit dieser Form beobachtet hat“
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, so lautet der berühmte letzte Satz des Tractatus logico-philosophicus von Ludwig Wittgenstein. Franz Hogel, Dipl.-Kommunikationsdesigner und Wittgenstein-Kenner aus Nürnberg, versucht in seinem Text, die philosophischen Paradoxien Wittgensteins, die sich aus der Selbstreferentialität seines sprachlichen Philosophierens ergeben, systemtheoretisch zu rekonstruieren und mit einen systemtheoretischen Konzept von Selbstreferentialität in Beziehung zu setzen.„Die Systemtheorie transformiert den wittgensteinschen Grundsatz, dass nicht gesagt werden könne, was sich nur zeigt, dahingehend, dass nicht zugleich gesagt werden kann, was sich zeigt. In einem nächsten Satz kann sehr wohl beschrieben (gesagt) werden, was der vorangegangene gezeigt hat. Die Sage des gegenwärtigen Satzes kann sich im Moment des Sagens wiederum nur zeigen usw. Hier kann man unschwer das Motiv der Beobachtung zweiter Ordnung, die immer auch für einen Beobachter dieser Beobachtung als Beobachtung erster Ordnung beschrieben werden kann, wiedererkennen. Oder, angelehnt an Spencer-Brown: Jede Markierung von etwas setzt eine Unterscheidung ein, die nicht zugleich, sondern erst später markiert werden kann. Was sich im Gesagten gezeigt haben mag der implizite Kontext, die ausgeblendete Unterscheidung, das unwritten cross (Spencer-Brown) , kann immer nur im Nachtrag gesagt werden. Dann stellt der Beobachter der Form fest, dass er schon immer mit dieser Form beobachtet hat“