26. Oktober 2008
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Nachdem Jochen Schweitzer vorgestern an dieser Stelle ein Plädoyer für eine„schulenübergreifenden Psychotherapie mit starker systemischer Grundierung“ gehalten hat, soll das Thema integrativer Psychotherapie heut noch einmal inhaltlich unterfüttert werden: mit einem ebenso ausführlichen wie fundierten Rezensionsaufsatz von Wolfgang Loth, den dieser Anfang des Jahres in„systeme“ veröffentlicht hat und der Ludwig Reiter zum 70. Geburtstag gewidmet ist. Gegenstand seiner facetten- und verweisungsreichen Überlegungen ist die zweite und überarbeitete Auflage des„Handbook of Psychotherapy Integration“, von John Norcross und Marvin Goldfried herausgegeben. Wolfgang Loths Überlegungen zum Schluss:
Nachdem Jochen Schweitzer vorgestern an dieser Stelle ein Plädoyer für eine„schulenübergreifenden Psychotherapie mit starker systemischer Grundierung“ gehalten hat, soll das Thema integrativer Psychotherapie heut noch einmal inhaltlich unterfüttert werden: mit einem ebenso ausführlichen wie fundierten Rezensionsaufsatz von Wolfgang Loth, den dieser Anfang des Jahres in„systeme“ veröffentlicht hat und der Ludwig Reiter zum 70. Geburtstag gewidmet ist. Gegenstand seiner facetten- und verweisungsreichen Überlegungen ist die zweite und überarbeitete Auflage des„Handbook of Psychotherapy Integration“, von John Norcross und Marvin Goldfried herausgegeben. Wolfgang Loths Überlegungen zum Schluss:  „Die Idee der Psychotherapie-Integration macht leichter Sinn, wenn die Integrität eigenständiger Ansätze geachtet und gewährleistet wird. Und wenn diese eigenständigen Ansätze sich nicht unter der Überschrift ‚Aus- oder Abgrenzung‘ konturieren, sondern unter der Überschrift: Beisteuern zu einem umfassenderen Phänomen auf der Basis transparenter (und somit diskutierbarer) Bevorzugungen/ Entscheidungen. Integration als Bereicherung der Diskussion, als Vision, die motiviert, und nicht als Diktat, das festschreibt. Die Idee der Integration könnte gewinnen, wenn nicht die (berufs-)politischen Erwägungen unterschiedlicher Provenienz im Vordergrund stehen, sondern die Bereitschaft, auf die Einschätzung des Geschehens durch die Hilfesuchenden selbst zu hören. Dann würde klarer, dass Integration nichts mit Hierarchien therapeutischer Konzepte zu tun hat, sondern mit der Fähigkeit, sich beim Hören auf die Hilfesuchenden gegenseitig zu unterstützen. Und schließlich scheint es auch notwendig, dass zur Integration auch die Person der HelferIn gehört. Das Hören auf die KlientInnen geschieht nicht als beliebige Variante eines automatisierten Vorgangs. Die Person der HelferIn in ihrer jeweiligen Aufmerksamkeit für das Geschehen ist das Pendant zu der Expertise und den Selbstheilungskräften der Hilfesuchenden. Das Team besteht nicht aus Störung und Maßnahme. Das Team besteht aus denen, die Hilfe suchen und denen, die dabei helfen, dass Hilfe erlebt wird. Vielleicht macht es daher Sinn, das Motto von Miller et al., das Ergebnis habe über den Prozess triumphiert, umzuwandeln in: Integration ist möglich als Triumph von Kooperation über Kolonisation“ Wer mitdiskutieren will, muss lesen.
„Die Idee der Psychotherapie-Integration macht leichter Sinn, wenn die Integrität eigenständiger Ansätze geachtet und gewährleistet wird. Und wenn diese eigenständigen Ansätze sich nicht unter der Überschrift ‚Aus- oder Abgrenzung‘ konturieren, sondern unter der Überschrift: Beisteuern zu einem umfassenderen Phänomen auf der Basis transparenter (und somit diskutierbarer) Bevorzugungen/ Entscheidungen. Integration als Bereicherung der Diskussion, als Vision, die motiviert, und nicht als Diktat, das festschreibt. Die Idee der Integration könnte gewinnen, wenn nicht die (berufs-)politischen Erwägungen unterschiedlicher Provenienz im Vordergrund stehen, sondern die Bereitschaft, auf die Einschätzung des Geschehens durch die Hilfesuchenden selbst zu hören. Dann würde klarer, dass Integration nichts mit Hierarchien therapeutischer Konzepte zu tun hat, sondern mit der Fähigkeit, sich beim Hören auf die Hilfesuchenden gegenseitig zu unterstützen. Und schließlich scheint es auch notwendig, dass zur Integration auch die Person der HelferIn gehört. Das Hören auf die KlientInnen geschieht nicht als beliebige Variante eines automatisierten Vorgangs. Die Person der HelferIn in ihrer jeweiligen Aufmerksamkeit für das Geschehen ist das Pendant zu der Expertise und den Selbstheilungskräften der Hilfesuchenden. Das Team besteht nicht aus Störung und Maßnahme. Das Team besteht aus denen, die Hilfe suchen und denen, die dabei helfen, dass Hilfe erlebt wird. Vielleicht macht es daher Sinn, das Motto von Miller et al., das Ergebnis habe über den Prozess triumphiert, umzuwandeln in: Integration ist möglich als Triumph von Kooperation über Kolonisation“ Wer mitdiskutieren will, muss lesen.
Hier zum vollständigen Text



 Der Südkoreaner Hoyong Choe hat seine Dissertation 2005 am Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie der FU Berlin vorgelegt, die auch online zugänglich ist:„Meine Dissertation zielt darauf ab, einen gemäßigten Konstruktivismus, d.h. denjenigen, der konstruktivistische Interessen oder Themen im komplementären Verhältnis zu nicht-metaphysischen Versionen des Realismus verfolgt, zu formulieren und dessen Potenziale bzw. Grenzen ansatzweise zu forschen. Nach einem Überblick über gegenwärtige konstruktivistische Ansätze (Kap. 2) habe ich die Grundzüge des gemäßigten Konstruktivismus im Anschluss an u.a. Putnam und Luhmann durch zwei Thesen charakterisiert (Kap. 3): 1. Der deskriptive Aspekt des Wissens lässt sich als begriffssysteminterne Angelegenheit begreifen (sog. externe Tatsachen innerhalb eines Begriffssystems). 2. Der konstruktive Aspekt des Wissens lässt sich als den kontingenten Charakter je eines Begriffsystems verstehen (begriffliche Relativität). Der gemäßigte Konstruktivismus macht es dabei deutlich, dass man außer zwei Deskriptionsbegriffen, d.h. einem metaphysischen und einem nicht-metaphysischen, auch zwei Konstruktionsbegriffe zu unterscheiden hat; im Sinne der unveräußerlichen Bedingtheit unseres Wissens durch ein Bezugssystem einerseits, im Sinne der Kontingenz oder Selektivität dieses Bezugssystems andererseits. Wenn der erste Konstruktionsbegriff zum Zweck der Weltbeobachtung nicht geeignet ist, und wenn der zweite vom ersten nicht ableitbar ist, dann kann man sagen, dass die Brauchbarkeit des ersten für empirische Forschung sehr beschränkt ist. M.a.W.: Die radikal-konstruktivistische Unterscheidung von Konstruktion/Deskription im Sinne von grundsätzlicher Konstruktivität unseres Wissens versus metaphysischer Illusion der Deskription ist m.E. wie die wittgensteinsche Leiter, die man hinaufsteigt und dann lieber wegwerfen soll. In diesem Sinne ist Glasersfelds Viabilitätskonzept zu kritisieren (Kap. 4): Dies ist zwar im Zusammenhang mit der als absolut angenommenen, realen Welt wohl vertretbar, aber für empirische Forschung unbrauchbar. Denn in einer empirischen Forschung steht das Verhältnis von Subjekten bzw. Organismen zu ihrer beobachtbaren Umwelt im Vordergrund. Und Viabilität im Gegensatz zur Deskription im metaphysischen Sinne ist eine andere Sache als Viabilität im Unterschied zur Deskription im gemäßigten Sinne. Maturanas Theorie autopoietischer Systeme ist m.E. als eine Pseudoempirie infolge undifferenzierter Begriffsverwendung aufzufassen (Kap. 5): Seine Hauptthesen wie die Autonomie der Lebewesen und die Subjektabhängigkeit der Kognition ergeben sich daraus, dass er aufgrund mangelnder begrifflicher Differenzierung zum einen methodologische mit objekttheoretischen Angelegenheiten ständig verwechselt, zum anderen auf objekttheoretischer Ebene funktionale auf strukturale Zusammenhänge reduziert. Seine Begriffsverwirrungen sind ein Beispiel dafür, dass der radikale Konstruktivismus mit seiner grundsätzlichen Option für die Konstruktivität des Wissens dazu tendiert, eine Homologie zwischen den Bedingungen des Wissens und dem dadurch Bedingten, eine Reduzierbarkeit eines Bedingten auf dessen Bedingungen hervorzuheben. Der gemäßigte Konstruktivismus demgegenüber bietet sich, mit ihrer differenzierten Handhabung von Begriffen wie v.a. Deskription und Konstruktion, als Vorschlag zur Fokusverschiebung im konstruktivistischen Diskurs an“ Die Lektüre dürfte einiges Nachdenken erfordern.
Der Südkoreaner Hoyong Choe hat seine Dissertation 2005 am Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie der FU Berlin vorgelegt, die auch online zugänglich ist:„Meine Dissertation zielt darauf ab, einen gemäßigten Konstruktivismus, d.h. denjenigen, der konstruktivistische Interessen oder Themen im komplementären Verhältnis zu nicht-metaphysischen Versionen des Realismus verfolgt, zu formulieren und dessen Potenziale bzw. Grenzen ansatzweise zu forschen. Nach einem Überblick über gegenwärtige konstruktivistische Ansätze (Kap. 2) habe ich die Grundzüge des gemäßigten Konstruktivismus im Anschluss an u.a. Putnam und Luhmann durch zwei Thesen charakterisiert (Kap. 3): 1. Der deskriptive Aspekt des Wissens lässt sich als begriffssysteminterne Angelegenheit begreifen (sog. externe Tatsachen innerhalb eines Begriffssystems). 2. Der konstruktive Aspekt des Wissens lässt sich als den kontingenten Charakter je eines Begriffsystems verstehen (begriffliche Relativität). Der gemäßigte Konstruktivismus macht es dabei deutlich, dass man außer zwei Deskriptionsbegriffen, d.h. einem metaphysischen und einem nicht-metaphysischen, auch zwei Konstruktionsbegriffe zu unterscheiden hat; im Sinne der unveräußerlichen Bedingtheit unseres Wissens durch ein Bezugssystem einerseits, im Sinne der Kontingenz oder Selektivität dieses Bezugssystems andererseits. Wenn der erste Konstruktionsbegriff zum Zweck der Weltbeobachtung nicht geeignet ist, und wenn der zweite vom ersten nicht ableitbar ist, dann kann man sagen, dass die Brauchbarkeit des ersten für empirische Forschung sehr beschränkt ist. M.a.W.: Die radikal-konstruktivistische Unterscheidung von Konstruktion/Deskription im Sinne von grundsätzlicher Konstruktivität unseres Wissens versus metaphysischer Illusion der Deskription ist m.E. wie die wittgensteinsche Leiter, die man hinaufsteigt und dann lieber wegwerfen soll. In diesem Sinne ist Glasersfelds Viabilitätskonzept zu kritisieren (Kap. 4): Dies ist zwar im Zusammenhang mit der als absolut angenommenen, realen Welt wohl vertretbar, aber für empirische Forschung unbrauchbar. Denn in einer empirischen Forschung steht das Verhältnis von Subjekten bzw. Organismen zu ihrer beobachtbaren Umwelt im Vordergrund. Und Viabilität im Gegensatz zur Deskription im metaphysischen Sinne ist eine andere Sache als Viabilität im Unterschied zur Deskription im gemäßigten Sinne. Maturanas Theorie autopoietischer Systeme ist m.E. als eine Pseudoempirie infolge undifferenzierter Begriffsverwendung aufzufassen (Kap. 5): Seine Hauptthesen wie die Autonomie der Lebewesen und die Subjektabhängigkeit der Kognition ergeben sich daraus, dass er aufgrund mangelnder begrifflicher Differenzierung zum einen methodologische mit objekttheoretischen Angelegenheiten ständig verwechselt, zum anderen auf objekttheoretischer Ebene funktionale auf strukturale Zusammenhänge reduziert. Seine Begriffsverwirrungen sind ein Beispiel dafür, dass der radikale Konstruktivismus mit seiner grundsätzlichen Option für die Konstruktivität des Wissens dazu tendiert, eine Homologie zwischen den Bedingungen des Wissens und dem dadurch Bedingten, eine Reduzierbarkeit eines Bedingten auf dessen Bedingungen hervorzuheben. Der gemäßigte Konstruktivismus demgegenüber bietet sich, mit ihrer differenzierten Handhabung von Begriffen wie v.a. Deskription und Konstruktion, als Vorschlag zur Fokusverschiebung im konstruktivistischen Diskurs an“ Die Lektüre dürfte einiges Nachdenken erfordern.
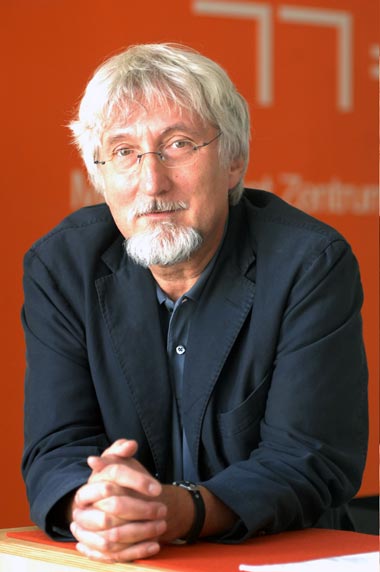



 So titelte die online-Ausgabe des„Handelsblatt“ gestern kritisch in einem Artikel von Eva-Maria Schur, der sich mit der Tatsache auseinandersetzt, dass Psychiater noch mehr als z.B. Herz-Kreislauf-Spezialisten finanziell mit der Pharmaindustrie unter einer Decke stecken – und zwar heimlich:„Anders als Krebs oder Herzinfarkte sind psychiatrische Krankheiten weder auf Röntgenbildern noch in den Blutwerten der Patienten zu erkennen. Die Diagnosekriterien sind Definitionssache, und deshalb ist es vergleichsweise einfach möglich, darauf Einfluss zu nehmen. In den vergangenen 50 Jahren explodierte die Zahl psychiatrischer Störungen von 106 auf inzwischen 297. Nicht nur der Fortschritt der Forschung könnte dafür der Grund sein, sondern auch ‚disease mongering‘, Geld verdienen mit der Ausweitung von Diagnosen, vermuten unabhängige Beobachter“
So titelte die online-Ausgabe des„Handelsblatt“ gestern kritisch in einem Artikel von Eva-Maria Schur, der sich mit der Tatsache auseinandersetzt, dass Psychiater noch mehr als z.B. Herz-Kreislauf-Spezialisten finanziell mit der Pharmaindustrie unter einer Decke stecken – und zwar heimlich:„Anders als Krebs oder Herzinfarkte sind psychiatrische Krankheiten weder auf Röntgenbildern noch in den Blutwerten der Patienten zu erkennen. Die Diagnosekriterien sind Definitionssache, und deshalb ist es vergleichsweise einfach möglich, darauf Einfluss zu nehmen. In den vergangenen 50 Jahren explodierte die Zahl psychiatrischer Störungen von 106 auf inzwischen 297. Nicht nur der Fortschritt der Forschung könnte dafür der Grund sein, sondern auch ‚disease mongering‘, Geld verdienen mit der Ausweitung von Diagnosen, vermuten unabhängige Beobachter“ Auf der Jahrestagung 2008 der DGSF in Essen (
Auf der Jahrestagung 2008 der DGSF in Essen ( Vom 10.-13.9.2008 fand die diesjährige Jahrestagung der DGSF statt, und erstmals war eine größere systemische Tagung der Hirnforschung und ihrer Bedeutung für eine systemische Praxis gewidmet. Katrin Richter aus Laboe hat einen (n)eu(ro)phorischen 🙂 Tagungsbericht verfasst, der die gute Stimmung der Tagung auf lebendige Weise wiedergibt:„Ich will ja nicht schon wieder damit beginnen, dass es beeindruckend war, das ist es ja immer. Man könnte nach diesem Kongress schon von ewiger neuer neuronaler Vernetzung sprechen. Ich weiß ja nicht, wie es anderen Teilnehmern geht, aber ich profitiere lange davon, bin hellauf begeistert, verschwinde mit meinen neuen Synapsennetzwerken in meiner Schatzkammer und summe leise vor mich hin. Es war der größte DGSF-Kongress überhaupt mit mehr als 600 Teilnehmern. Die Qualität stimmte“
Vom 10.-13.9.2008 fand die diesjährige Jahrestagung der DGSF statt, und erstmals war eine größere systemische Tagung der Hirnforschung und ihrer Bedeutung für eine systemische Praxis gewidmet. Katrin Richter aus Laboe hat einen (n)eu(ro)phorischen 🙂 Tagungsbericht verfasst, der die gute Stimmung der Tagung auf lebendige Weise wiedergibt:„Ich will ja nicht schon wieder damit beginnen, dass es beeindruckend war, das ist es ja immer. Man könnte nach diesem Kongress schon von ewiger neuer neuronaler Vernetzung sprechen. Ich weiß ja nicht, wie es anderen Teilnehmern geht, aber ich profitiere lange davon, bin hellauf begeistert, verschwinde mit meinen neuen Synapsennetzwerken in meiner Schatzkammer und summe leise vor mich hin. Es war der größte DGSF-Kongress überhaupt mit mehr als 600 Teilnehmern. Die Qualität stimmte“