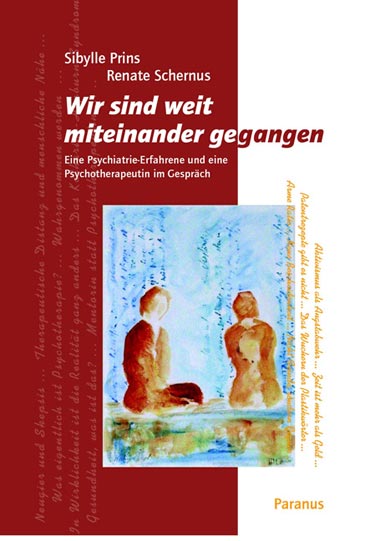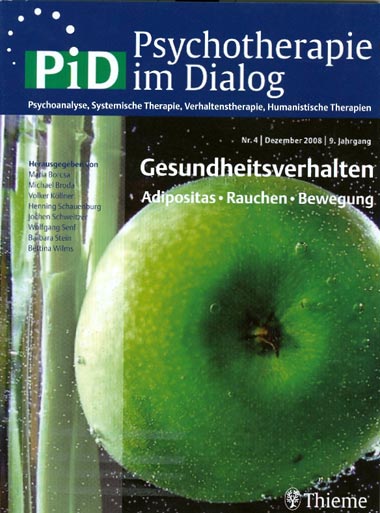
“
und das höchste Gut ist doch die Gesundheit! – kaum eine Geburtstagsansprache kommt ohne diesen Satz aus, und doch ist er blanker Unsinn. Niemals in der gesamten philosophischen Tradition des Ostens und des Westens ist etwas so Zerbrechliches wie die Gesundheit der Güter höchstes gewesen. Noch bei Kant war das höchste Gut die Einheit von Heiligkeit und Glückseligkeit oder Gott. Doch heute ist alles anders. Wir leben im Zeitalter der real existierenden Gesundheitsreligion. Alle Üblichkeiten der Altreligionen sind inzwischen im Gesundheitswesen angekommen“. So eröffnet Manfred Lütz, Leitender Arzt einer Kölner psychiatrischen Klinik mit philosophischem und theologischem Background seinen Artikel über den neuen Fetisch Gesundheit. Ansonsten ist das aktuelle Heft der Psychotherapie im Dialog allerdings eher der Frage gewidmet, welche Rolle jetzt und in Zukunft auf die Psychotherapie bei der Förderung von Gesundheitsverhalten zukommt. Die Gast-Herausgeber Stephan Herpertz und Volker Köllner sehen hier eine Chance:„Obwohl Gesundheit als„höchstes Gut gepriesen wird und die Gesundheitswirtschaft boomt, setzen sich in unserer Gesellschaft offensichtlich Verhaltensmuster durch, welche die Gesundheit schädigen. Als eine Reaktion auf diese alarmierende Entwicklung plant die Bundesregierung, in einem Präventionsgesetz die Prävention neben Akutbehandlung, Rehabilitation und Pflege als vierte Säule im Gesundheitswesen zu etablieren. Maßnahmen und Ziele sollen in einem nationalen Rehabilitationsrat erarbeitet werden, dem auch VertreterInnen der Bundesärztekammer und der Kammer der psychologischen Psychotherapeuten angehören sollen. Insgesamt sollen Mittel in der Größenordnung von 300 Mio./Jahr bereitgestellt werden“ Es geht also nicht nur um ein spannendes Thema, sondern auch um einen Markt.
Zu den vollständigen abstracts

 Im neuen Merkur-Heft ist eine systemtheoretische Beschreibung der gegenwärtigen Situation von Politik und Politikern zu finden, die der Soziologe Helmut Fangmann (Foto: Fuel-FU-Berlin) verfasst hat und die auch online auf der website des Merkur zu finden ist. Fangmann verfolgt dabei die„Hypothese, dass Politik nicht problemorientiert handeln, sondern nur erfolgsorientiert kommunizieren kann. Es geht nicht um Fremdreferenz wie etwa die Lösung sozialer Probleme, sondern um Selbstreferenz, nämlich den politischen Erfolg. Der ist in der Regel aber nur zu haben, wenn ein Bezug zu vermeintlichen gesellschaftlichen Problemlagen hergestellt wird. Die wiederum werden oft erst durch entsprechende Artikulationen im politischen System kreiert und durch die Medien verbreitet. Politik und Medien übernehmen damit zugleich eine Filterfunktion oder, wenn man so will, eine Priorisierung der Problemwahrnehmung. Denn soviel ist klar: Zu viele Probleme zur gleichen Zeit hält keine Gesellschaft aus. Und da Probleme soziale Konstrukte sind und keine Wetterereignisse, lässt sich die Zahl der in der öffentlichen Kommunikation zugelassenen Probleme gut kontrollieren“ Der Autor war früher u.a. Mitarbeiter des Niedersächsischen Wissenschaftsministeriums und Kanzler der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und arbeitet jetzt als Leitender Ministerialrat in der Abteilung Hochschulmanagement des Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen. In seinem Beitrag geht es auch um politische Leerformeln oder (nach Luhmann) Kontingenzformeln, mit denen alles oder nichts begründet werden kann:„Vielleicht hat der Begriff »Innovation« ja bereits die Qualität einer solchen Kontingenzformel erreicht. Immerhin wurde in Nordrhein-Westfalen unlängst ein Innovationsministerium eingerichtet und die kaum operationalisierbare Zielmarke »Innovationsland Nr. 1« ausgegeben“. Dass Fangmann selbst in diesem Kontext arbeitet, ist allerdings unter online-merkur nicht zu erkennen. Vielleicht ist ja ein Bericht aus der Höhle des Löwen in Vorbereitung 🙂
Im neuen Merkur-Heft ist eine systemtheoretische Beschreibung der gegenwärtigen Situation von Politik und Politikern zu finden, die der Soziologe Helmut Fangmann (Foto: Fuel-FU-Berlin) verfasst hat und die auch online auf der website des Merkur zu finden ist. Fangmann verfolgt dabei die„Hypothese, dass Politik nicht problemorientiert handeln, sondern nur erfolgsorientiert kommunizieren kann. Es geht nicht um Fremdreferenz wie etwa die Lösung sozialer Probleme, sondern um Selbstreferenz, nämlich den politischen Erfolg. Der ist in der Regel aber nur zu haben, wenn ein Bezug zu vermeintlichen gesellschaftlichen Problemlagen hergestellt wird. Die wiederum werden oft erst durch entsprechende Artikulationen im politischen System kreiert und durch die Medien verbreitet. Politik und Medien übernehmen damit zugleich eine Filterfunktion oder, wenn man so will, eine Priorisierung der Problemwahrnehmung. Denn soviel ist klar: Zu viele Probleme zur gleichen Zeit hält keine Gesellschaft aus. Und da Probleme soziale Konstrukte sind und keine Wetterereignisse, lässt sich die Zahl der in der öffentlichen Kommunikation zugelassenen Probleme gut kontrollieren“ Der Autor war früher u.a. Mitarbeiter des Niedersächsischen Wissenschaftsministeriums und Kanzler der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und arbeitet jetzt als Leitender Ministerialrat in der Abteilung Hochschulmanagement des Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen. In seinem Beitrag geht es auch um politische Leerformeln oder (nach Luhmann) Kontingenzformeln, mit denen alles oder nichts begründet werden kann:„Vielleicht hat der Begriff »Innovation« ja bereits die Qualität einer solchen Kontingenzformel erreicht. Immerhin wurde in Nordrhein-Westfalen unlängst ein Innovationsministerium eingerichtet und die kaum operationalisierbare Zielmarke »Innovationsland Nr. 1« ausgegeben“. Dass Fangmann selbst in diesem Kontext arbeitet, ist allerdings unter online-merkur nicht zu erkennen. Vielleicht ist ja ein Bericht aus der Höhle des Löwen in Vorbereitung 🙂
 Wie Florian Rötzer in einem Artikel für das online-Magazin Telepolis vom 24.2.09 schreibt, haben sich in den USA zwei Richter am vergangenen Donnerstag schuldig bekannt, Hunderte von Kindern in privatwirtschaftlich geführte Gefängnisse geschickt zu haben, weil sie dafür Geld bekommen haben. Der ungeheuerliche Fall des Jugendrichters Mark A. Ciavarella Jr. und des Vorsitzender Richters Michael T. Conahan aus Pennsylvania zeigt anschaulich, wohin manches Outsourcing staatlicher Aufgaben führen kann.
Wie Florian Rötzer in einem Artikel für das online-Magazin Telepolis vom 24.2.09 schreibt, haben sich in den USA zwei Richter am vergangenen Donnerstag schuldig bekannt, Hunderte von Kindern in privatwirtschaftlich geführte Gefängnisse geschickt zu haben, weil sie dafür Geld bekommen haben. Der ungeheuerliche Fall des Jugendrichters Mark A. Ciavarella Jr. und des Vorsitzender Richters Michael T. Conahan aus Pennsylvania zeigt anschaulich, wohin manches Outsourcing staatlicher Aufgaben führen kann. 

 „So, jetzt ist es so weit. Jetzt schreibe ich das mal auf, was für bemerkenswerte Anrufe ich mitunter entgegennehme nein, nicht die von der Lottogesellschaft mit garantierter Gewinnchance beim Kauf eines Jahresloses zu 298,- Euro, und auch nicht die mit dem altruistischen Hinweis auf den günstigsten Handytarif (Wie hoch ist denn Ihre monatliche Telefonrechnung?). Nein, und auch nicht die, die per Computerstimme einen ganz dringenden Rückruf zur Abholung eines Gewinns einfordern.
„So, jetzt ist es so weit. Jetzt schreibe ich das mal auf, was für bemerkenswerte Anrufe ich mitunter entgegennehme nein, nicht die von der Lottogesellschaft mit garantierter Gewinnchance beim Kauf eines Jahresloses zu 298,- Euro, und auch nicht die mit dem altruistischen Hinweis auf den günstigsten Handytarif (Wie hoch ist denn Ihre monatliche Telefonrechnung?). Nein, und auch nicht die, die per Computerstimme einen ganz dringenden Rückruf zur Abholung eines Gewinns einfordern. Wie heute aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, hat die Deutsche Bahn eine neue Spitzeläffäre. Neben den mittlerweile bekannt gewordenen 17 Späh-Projekten zur angeblichen Korruptionsbekämpfung, die von der Detektei Network im Auftrag der Deutschen Bahn durchgeführt worden sind, ist nun ein weiteres Projekt bekannt geworden, das der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn vor fast drei Jahren selbst in Auftrag gegeben hat. Aus den dem systemagazin vorliegenden Projektunterlagen geht hervor, dass die Detektei bei der Suche nach Elementen, die das Image und den Unternehmenswert der Deutschen Bahn massiv reduziert haben, schon früh auf eine verdächtige Person namens Hartmut Mehdorn gestoßen ist. Auf Verlangen des Vorstandsvorsitzenden wurden damals umgehend massive und vollständige Überwachungsmaßnahmen in Gang gesetzt, die unter dem Projektnamen„Achsen des Bösen“ firmierten. Da der verdächtigte Mehdorn in der Öffentlichkeit einen gewissen Ruf geltend machen und sich auch lange auf politische Verbindungen stützen konnte, soll der Vorstandsvorsitzende lange gezögert haben, Mehdorn zu entlassen, obwohl die Beweislast immer drückender wurde. Zuletzt soll Hartmut Mehdorn sogar den Vorstandsvorsitzenden mit intimen Dokumenten und Fotos erpresst haben, an ihm festzuhalten. Unter dem gegenwärtigen Druck der Öffentlichkeit zeichnet sich aber ab, dass sich der Vorsitzende der Deutschen Bahn in den nächsten Tagen von Hartmut Mehdorn trennen wird. Kritiker warnen aber bereits davor, das Amt des Vorstandsvorsitzenden eines solch bedeutsamen Unternehmens wie der Deutschen Bahn in die Hände einer Teilpersönlichkeit zu legen.
Wie heute aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, hat die Deutsche Bahn eine neue Spitzeläffäre. Neben den mittlerweile bekannt gewordenen 17 Späh-Projekten zur angeblichen Korruptionsbekämpfung, die von der Detektei Network im Auftrag der Deutschen Bahn durchgeführt worden sind, ist nun ein weiteres Projekt bekannt geworden, das der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn vor fast drei Jahren selbst in Auftrag gegeben hat. Aus den dem systemagazin vorliegenden Projektunterlagen geht hervor, dass die Detektei bei der Suche nach Elementen, die das Image und den Unternehmenswert der Deutschen Bahn massiv reduziert haben, schon früh auf eine verdächtige Person namens Hartmut Mehdorn gestoßen ist. Auf Verlangen des Vorstandsvorsitzenden wurden damals umgehend massive und vollständige Überwachungsmaßnahmen in Gang gesetzt, die unter dem Projektnamen„Achsen des Bösen“ firmierten. Da der verdächtigte Mehdorn in der Öffentlichkeit einen gewissen Ruf geltend machen und sich auch lange auf politische Verbindungen stützen konnte, soll der Vorstandsvorsitzende lange gezögert haben, Mehdorn zu entlassen, obwohl die Beweislast immer drückender wurde. Zuletzt soll Hartmut Mehdorn sogar den Vorstandsvorsitzenden mit intimen Dokumenten und Fotos erpresst haben, an ihm festzuhalten. Unter dem gegenwärtigen Druck der Öffentlichkeit zeichnet sich aber ab, dass sich der Vorsitzende der Deutschen Bahn in den nächsten Tagen von Hartmut Mehdorn trennen wird. Kritiker warnen aber bereits davor, das Amt des Vorstandsvorsitzenden eines solch bedeutsamen Unternehmens wie der Deutschen Bahn in die Hände einer Teilpersönlichkeit zu legen. Für das neue Heft der Familiendynamik hat Hans Rudi Fischer ein Gespräch mit Helm Stierlin geführt, das dankenswerterweise auch online verfügbar ist. Helm Stierlin berichtet hier von den Wurzeln der Familientherapie, die viel damit zu tun haben, dass„freche“ Menschen wie Jay Haley, John Weakland oder Paul Watzlawick relativ unbekümmert die psychoanalytischen Dogmen der Zeit ignoriert haben und damit neue Akzente setzen konnten, warnt aber auch davor, dass der Begriff„systemisch“ heute nicht mehr viel aussagt, da er inflationär eingesetzt werde. Der„Familiendynamik“ (und eigentlich uns allen) schreibt er dementsprechend ins Stammbuch:„Es sollten gerade traditionell schwierige Felder wie Psychosentherapie oder Psychosomatik auch sehr kontrovers diskutiert werden können. Dazu sollte man auch Analytiker zu Worte kommen lassen, auch gerade bei der Frage, wieviele Sitzungen in alternativen Therapieansätzen nötig erscheinen. Ich finde es wichtig, gerade konfliktbesetzte Themen von unterschiedlichen Seiten her zu beleuchten und dadurch Spannung und Kontroverse hineinzubringen. Die ‚Familiendynamik‘ sollte nicht eine Art Lehrbuch werden“.
Für das neue Heft der Familiendynamik hat Hans Rudi Fischer ein Gespräch mit Helm Stierlin geführt, das dankenswerterweise auch online verfügbar ist. Helm Stierlin berichtet hier von den Wurzeln der Familientherapie, die viel damit zu tun haben, dass„freche“ Menschen wie Jay Haley, John Weakland oder Paul Watzlawick relativ unbekümmert die psychoanalytischen Dogmen der Zeit ignoriert haben und damit neue Akzente setzen konnten, warnt aber auch davor, dass der Begriff„systemisch“ heute nicht mehr viel aussagt, da er inflationär eingesetzt werde. Der„Familiendynamik“ (und eigentlich uns allen) schreibt er dementsprechend ins Stammbuch:„Es sollten gerade traditionell schwierige Felder wie Psychosentherapie oder Psychosomatik auch sehr kontrovers diskutiert werden können. Dazu sollte man auch Analytiker zu Worte kommen lassen, auch gerade bei der Frage, wieviele Sitzungen in alternativen Therapieansätzen nötig erscheinen. Ich finde es wichtig, gerade konfliktbesetzte Themen von unterschiedlichen Seiten her zu beleuchten und dadurch Spannung und Kontroverse hineinzubringen. Die ‚Familiendynamik‘ sollte nicht eine Art Lehrbuch werden“. „Machen wir uns nichts vor: Das authentische, bis zum Tode sich selbst treu bleibende Subjekt, dem Authentizität aus der heiligen Stille autonomen Entscheidens zuwächst das gibt es nicht mehr. Die Heterogenität unserer Zeit wäre von ihm nicht mehr ausbalancierbar. Es hat sich aufgeben müssen. Die biologischen Systeme, die Bewusstseinsmaschinen und die Teilnehmer an der endlos scheinenden Kommunikation, aus der Gesellschaft besteht, oder kurz: wir Menschen werden in Zukunft anders navigieren. Wir werden mit Unterscheidungen arbeiten, mit variablen Beobachterrollen, wir werden darum bemüht sein, Anschlüsse nicht zu verpassen und uns im Schema Variation, Selektion, Reorganisation bewegen. Die Orte, an denen wir dies tun, müssen da mithalten. Denn wer möchte sein Kind schon statt in eine Schule in ein Museum schicken, wo es gelangweilt ihm seltsam und weltfremd erscheinende Bildungsmirakel bestaunen darf, wo es Lehrer/innen aus Fleisch und Blut erlebt, deren Idealismus zwar zu häufig mit Füßen getreten wurde und deshalb längst begonnen hat, sich selbst leid zu tun, die dem Glauben an die prinzipiell mögliche Vernunftautonomie ihrer Schüler/innen jedoch irgendwann einmal Unerschütterlichkeit verordnet und ihn damit ein- für allemal blind gestellt haben wider jede bessere Praxiserfahrung? Wenn der Schulstress jene Lehrer/innen mal eine Zeit lang in Ruhe lässt, flammt ihre Begeisterung für jenen Menschen, der in der metaphysisch angehauchten Aura erhabener Wesentlichkeit schwebt, immer wieder neu auf und ihre durch Diskrepanz dieser Vorstellung mit der Wirklichkeit nicht ausbleibende Verbitterung kann zwar immer wieder weg geschoben werden, nagt aber trotzdem insgeheim an ihren Kräften, die sie so dringend benötigten für die konstruktive Arbeit an den tatsächlich reichhaltig vorhandenen Problemen ihrer Schüler/innen“ So lautet das Fazit eines lesenwerten – weil gedankenreichen und gut geschriebenen – Artikels in der
„Machen wir uns nichts vor: Das authentische, bis zum Tode sich selbst treu bleibende Subjekt, dem Authentizität aus der heiligen Stille autonomen Entscheidens zuwächst das gibt es nicht mehr. Die Heterogenität unserer Zeit wäre von ihm nicht mehr ausbalancierbar. Es hat sich aufgeben müssen. Die biologischen Systeme, die Bewusstseinsmaschinen und die Teilnehmer an der endlos scheinenden Kommunikation, aus der Gesellschaft besteht, oder kurz: wir Menschen werden in Zukunft anders navigieren. Wir werden mit Unterscheidungen arbeiten, mit variablen Beobachterrollen, wir werden darum bemüht sein, Anschlüsse nicht zu verpassen und uns im Schema Variation, Selektion, Reorganisation bewegen. Die Orte, an denen wir dies tun, müssen da mithalten. Denn wer möchte sein Kind schon statt in eine Schule in ein Museum schicken, wo es gelangweilt ihm seltsam und weltfremd erscheinende Bildungsmirakel bestaunen darf, wo es Lehrer/innen aus Fleisch und Blut erlebt, deren Idealismus zwar zu häufig mit Füßen getreten wurde und deshalb längst begonnen hat, sich selbst leid zu tun, die dem Glauben an die prinzipiell mögliche Vernunftautonomie ihrer Schüler/innen jedoch irgendwann einmal Unerschütterlichkeit verordnet und ihn damit ein- für allemal blind gestellt haben wider jede bessere Praxiserfahrung? Wenn der Schulstress jene Lehrer/innen mal eine Zeit lang in Ruhe lässt, flammt ihre Begeisterung für jenen Menschen, der in der metaphysisch angehauchten Aura erhabener Wesentlichkeit schwebt, immer wieder neu auf und ihre durch Diskrepanz dieser Vorstellung mit der Wirklichkeit nicht ausbleibende Verbitterung kann zwar immer wieder weg geschoben werden, nagt aber trotzdem insgeheim an ihren Kräften, die sie so dringend benötigten für die konstruktive Arbeit an den tatsächlich reichhaltig vorhandenen Problemen ihrer Schüler/innen“ So lautet das Fazit eines lesenwerten – weil gedankenreichen und gut geschriebenen – Artikels in der