 So lange ein umwelt-sensibles und ökologisch verantwortliches Verhalten eher mit Verzichtserleben und Selbstquälerei in Verbindung gebracht wird, dürfte es eine ziemlich harte Nuss bleiben, hier zu einem tragfähigen commitment zu kommen. Einerseits sind Sorgen um den Zustand unserer
So lange ein umwelt-sensibles und ökologisch verantwortliches Verhalten eher mit Verzichtserleben und Selbstquälerei in Verbindung gebracht wird, dürfte es eine ziemlich harte Nuss bleiben, hier zu einem tragfähigen commitment zu kommen. Einerseits sind Sorgen um den Zustand unserer  „Welt“ (des Klimas, der Meereserwärmung, der Eisbären,
) mittlerweile en vogue wenn auch zur Zeit finanztechnisch vernebelt -, doch mag auch kaum jemand„zurück zur Natur“, wenn die Natur es uns nicht gemütlich genug macht. Kirk Warren Brown (Foto links) (von der kanadischen McGill Universität) und Tim Kasser (Foto rechts (vom Knox College in Galesburg, Illinois) haben dazu im Jahr 2005 eine Untersuchung veröffentlicht („Are Psychological and Ecological Well-Being Compatible? The Role of Values, Mindfulness, and Lifestyle„, Social Indicators Research 74: 349-368).
„Welt“ (des Klimas, der Meereserwärmung, der Eisbären,
) mittlerweile en vogue wenn auch zur Zeit finanztechnisch vernebelt -, doch mag auch kaum jemand„zurück zur Natur“, wenn die Natur es uns nicht gemütlich genug macht. Kirk Warren Brown (Foto links) (von der kanadischen McGill Universität) und Tim Kasser (Foto rechts (vom Knox College in Galesburg, Illinois) haben dazu im Jahr 2005 eine Untersuchung veröffentlicht („Are Psychological and Ecological Well-Being Compatible? The Role of Values, Mindfulness, and Lifestyle„, Social Indicators Research 74: 349-368).
Es ging ihnen um die Frage, ob es möglich sei, so zu leben, dass man sowohl das persönliche als auch das„planetarische“ Wohlergehen fördere. Als Ergebnis ihrer Studie halten sie fest, dass persönliches Wohlbefinden und ökologisch verantwortliches Verhalten als komplementär angesehen werden können. Glücklichere Menschen lebten umweltverträglicher wenigstens die, die an dieser Untersuchung teilnahmen. Die Autoren identifizierten zwei Faktoren, die das ermöglichten: eine intrinsische Wertorientierung und Achtsamkeit. Zusammengefasst:„Die Ergebnisse dieser Studie nähren die Hoffnung, dass eine wechselseitig vorteilhafte Beziehung besteht zwischen persönlichem und planetarischem Wohlbefinden, besonders dann, wenn unterstützende Faktoren wie Achtsamkeit und intrinsische Werte kultiviert werden können“. Zur Studie von Brown und Kasser geht es hier
5. April 2009
von Wolfgang Loth
Keine Kommentare



 Unter diesem Titel hielt Kurt Ludewig im November 1998 einen Festvortrag bei der Jubiläumstagung„15 Jahre BIF – Berliner Institut für Familientherapie“ Das Institut ist nun schon 25 Jahre alt und unser Geschichte wird auch immer länger – kein Grund, nicht immer wieder mal einen Blick darauf zu werfen und sich die verschiedenen Entwicklungsstränge mal wieder vor Augen zu führen – gerade angesichts der momentanen berufs- und weiterbildungspolitischen Situation. Der Vortrag ist auch online zu lesen,
Unter diesem Titel hielt Kurt Ludewig im November 1998 einen Festvortrag bei der Jubiläumstagung„15 Jahre BIF – Berliner Institut für Familientherapie“ Das Institut ist nun schon 25 Jahre alt und unser Geschichte wird auch immer länger – kein Grund, nicht immer wieder mal einen Blick darauf zu werfen und sich die verschiedenen Entwicklungsstränge mal wieder vor Augen zu führen – gerade angesichts der momentanen berufs- und weiterbildungspolitischen Situation. Der Vortrag ist auch online zu lesen,  Die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, hat Hartmut Mehdorn nach seinem Rücktritt vom Vorstand der Deutschen Bahn die Zuständigkeiten für Vertrieb, Vortrieb und Antrieb im Vorstand ihres Verbandes angeboten.„Als Dauervertriebene wusste ich auch schon vor meiner Vertreibung von dem mir bestimmten Platz im Stiftungsrat ‚Flucht, Vertreibung, Versöhnung‘ , was es heißt, sich nicht an seinem angestammten Platz aufhalten zu können. Die Zahl der Vertreibungen von Leistungsträgern aus ihrem Ämtern nimmt gegenwärtig in erschreckendem Maße zu. Gegen diese forgesetzten Menschenrechtsverletzungen müssen wir uns entschieden zur Wehr setzen“. Zwar gilt Mehdorn als generell an Vertriebsfragen interessiert, bislang ist aber noch unklar, ob er das Angebot annehmen wird oder nicht. Unbestätigten Berichten zufolge soll Mehdorn auch als neuer Chef der Kölner Verkehrsbetriebe KVB im Gespräch sein, um den Weiterbau der U-Bahn voranzutreiben und die KVB durch ein neues und komplexes Tarifsystem, überzeugende Mitarbeiter-Screenings und Stillegung unrentabler Bahnverbindungen mit dem Ziel eines baldigen Börsenganges zu sanieren.
Die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, hat Hartmut Mehdorn nach seinem Rücktritt vom Vorstand der Deutschen Bahn die Zuständigkeiten für Vertrieb, Vortrieb und Antrieb im Vorstand ihres Verbandes angeboten.„Als Dauervertriebene wusste ich auch schon vor meiner Vertreibung von dem mir bestimmten Platz im Stiftungsrat ‚Flucht, Vertreibung, Versöhnung‘ , was es heißt, sich nicht an seinem angestammten Platz aufhalten zu können. Die Zahl der Vertreibungen von Leistungsträgern aus ihrem Ämtern nimmt gegenwärtig in erschreckendem Maße zu. Gegen diese forgesetzten Menschenrechtsverletzungen müssen wir uns entschieden zur Wehr setzen“. Zwar gilt Mehdorn als generell an Vertriebsfragen interessiert, bislang ist aber noch unklar, ob er das Angebot annehmen wird oder nicht. Unbestätigten Berichten zufolge soll Mehdorn auch als neuer Chef der Kölner Verkehrsbetriebe KVB im Gespräch sein, um den Weiterbau der U-Bahn voranzutreiben und die KVB durch ein neues und komplexes Tarifsystem, überzeugende Mitarbeiter-Screenings und Stillegung unrentabler Bahnverbindungen mit dem Ziel eines baldigen Börsenganges zu sanieren.
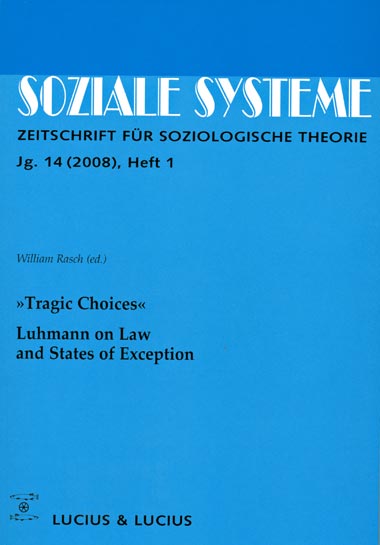
 Mehdorn!
Mehdorn! Auf der website der Systemischen Gesellschaft (SG) sind Fragen und Antworten zur Feststellung der wissenschaftlichen Fundierung der Systemischen Therapie durch den wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie im Dezember 2008 veröffentlicht worden, die erst einmal Klarheit in den aktuellen Stand der Dinge bringen sollen. Wer also wissen will, wer der WBP überhaupt ist, was er beschlossen hat, was dieser Beschluss bedeutet, ob eine Approbation mit der Weiterbildung in Systemischer Therapie erreicht werden kann und ob Chancen einer Abrechnung mit den Krankenkassen bestehen, kann sich hier informieren.
Auf der website der Systemischen Gesellschaft (SG) sind Fragen und Antworten zur Feststellung der wissenschaftlichen Fundierung der Systemischen Therapie durch den wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie im Dezember 2008 veröffentlicht worden, die erst einmal Klarheit in den aktuellen Stand der Dinge bringen sollen. Wer also wissen will, wer der WBP überhaupt ist, was er beschlossen hat, was dieser Beschluss bedeutet, ob eine Approbation mit der Weiterbildung in Systemischer Therapie erreicht werden kann und ob Chancen einer Abrechnung mit den Krankenkassen bestehen, kann sich hier informieren. In einem
In einem 