1. Mai 2009
von Wolfgang Loth
Keine Kommentare
 In zwei Jahren, so heißt es, werde die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten leben. New York war vor 50 Jahren die einzige Stadt der Erde mit mehr als 10 Millionen Bewohnern. Heute gibt es bereits 19 Mega-Cities diesen Ausmaßes. In einem Aufsatz für die C.A.P.-News, einem Online-Journal des Centrums für angewandte Politikforschung, schreibt Chloé Lachauer, es gehe in der Konsequenz darum, für die Zukunftsgesellschaft Lösungsansätze zu finden, mit diesen neuen Formen der Stadtlandschaften ökologisch, gesellschaftspolitisch und ökonomisch fertig zu werden. Bezeichnenderweise hat die größte Rückversicherung der Welt, die Münchner Rück, angesichts der neuesten Prognosen der Vereinten Nationen und anlässlich der UN-Konferenz für Katastrophenbegrenzung jüngst eine Studie publiziert, die die Mega-Cities der Zukunft als hoch komplexe Großrisiken betiteln, die nicht mehr versicherbar seien. Nicht nur ökologische Katastrophen werden vorausgesehen, sondern auch anarchische Gewaltzustände in den Städten, und eine Art Urban Sprawl im Sinne einer riesenhaften Slumisierung (Foto: http://students.umf.maine.edu). Filme wie Slumdog Millionär deuten das Elend zwar an, doch retten sie sich immer noch in illusionäre, individuelle (Er-)Lösungen. Ich gehe davon aus, dass systemtheoretische und systemische Sichtweisen nicht beim Entwickeln individueller Lösungswege stehen bleiben können. In einem Exposé von Balz Bodenmann (Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung der ETH Zürich) werden die zur Zeit übersehbaren Fakten zusammenfassend skizziert. Der Autor resümiert: Der Weg der Städte im 21. Jahrhundert wird weder ohne Hindernisse noch einfach sein, zumal der wachsende Wohlstand grössere Ungleichgewichte sowohl innerhalb der einzelnen Länder als auch zwischen ihnen mit sich bringen wird. Die Wirtschaftsstruktur der betroffenen Länder, die Millionen Menschen zur Sicherung des Lebensunterhalts dient, wird ständig der Bedrohung durch eine fortschreitende, vom technischen Fortschritt vorangetriebene Globalisierung ausgesetzt sein. Deshalb wird einerseits die Ungleichheit zwischen den Stadtbewohnern weiterhin eine Herausforderung bleiben und andererseits die Verbesserung der Lebensbedingungen der Stadtbevölkerung weiterhin eine zentrale Aufgabe der Stadtentwicklung darstellen.
In zwei Jahren, so heißt es, werde die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten leben. New York war vor 50 Jahren die einzige Stadt der Erde mit mehr als 10 Millionen Bewohnern. Heute gibt es bereits 19 Mega-Cities diesen Ausmaßes. In einem Aufsatz für die C.A.P.-News, einem Online-Journal des Centrums für angewandte Politikforschung, schreibt Chloé Lachauer, es gehe in der Konsequenz darum, für die Zukunftsgesellschaft Lösungsansätze zu finden, mit diesen neuen Formen der Stadtlandschaften ökologisch, gesellschaftspolitisch und ökonomisch fertig zu werden. Bezeichnenderweise hat die größte Rückversicherung der Welt, die Münchner Rück, angesichts der neuesten Prognosen der Vereinten Nationen und anlässlich der UN-Konferenz für Katastrophenbegrenzung jüngst eine Studie publiziert, die die Mega-Cities der Zukunft als hoch komplexe Großrisiken betiteln, die nicht mehr versicherbar seien. Nicht nur ökologische Katastrophen werden vorausgesehen, sondern auch anarchische Gewaltzustände in den Städten, und eine Art Urban Sprawl im Sinne einer riesenhaften Slumisierung (Foto: http://students.umf.maine.edu). Filme wie Slumdog Millionär deuten das Elend zwar an, doch retten sie sich immer noch in illusionäre, individuelle (Er-)Lösungen. Ich gehe davon aus, dass systemtheoretische und systemische Sichtweisen nicht beim Entwickeln individueller Lösungswege stehen bleiben können. In einem Exposé von Balz Bodenmann (Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung der ETH Zürich) werden die zur Zeit übersehbaren Fakten zusammenfassend skizziert. Der Autor resümiert: Der Weg der Städte im 21. Jahrhundert wird weder ohne Hindernisse noch einfach sein, zumal der wachsende Wohlstand grössere Ungleichgewichte sowohl innerhalb der einzelnen Länder als auch zwischen ihnen mit sich bringen wird. Die Wirtschaftsstruktur der betroffenen Länder, die Millionen Menschen zur Sicherung des Lebensunterhalts dient, wird ständig der Bedrohung durch eine fortschreitende, vom technischen Fortschritt vorangetriebene Globalisierung ausgesetzt sein. Deshalb wird einerseits die Ungleichheit zwischen den Stadtbewohnern weiterhin eine Herausforderung bleiben und andererseits die Verbesserung der Lebensbedingungen der Stadtbevölkerung weiterhin eine zentrale Aufgabe der Stadtentwicklung darstellen.
Zum Beitrag von Bodenmann geht es hier
und zum Beitrag von Lachauer hier
raufgesprungen

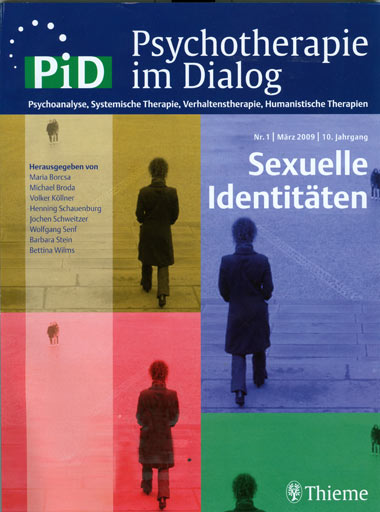
 Heute vor 85 Jahren, am 9. Mai 1924, wurde Harold A. Goolishian in Lowell, Massachusetts geboren. Goolishian, der am 10. November 1991 in Galveston, Texas, im Alter von 67 Jahren starb, war ein Pionier der Familientherapie und langjähriger Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie an der Medizinischen Fakultät Galveston der University of Texas. Gemeinsam mit Harlene Anderson und Paul Dell gründete er 1977 das das Galveston Family Institute in Texas. Sein und Harlene Andersons Konzept des„Problemdeterminierten Systems“, das hierzulande vor allem von Kurt Ludewig bekannt gemacht worden ist, hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Systemischen Therapie gespielt. Im Internet sind auf einer norwegischen website sieben Videos anzusehen, die der norwegische Psychotherapeut Steven Balmbra von einem Seminar mit Harry Goolishian im Januar 1988 gemacht hat, als dieser eine Woche mit Vorträgen und Workshops im Child and Adolescent Department des Nordland Psychiatric Hospital in Bodø, Nordnorwegen, zu Gast war. Insgesamt dauern die Videos fast 3,5 Stunden und geben einen Einblick nicht nur in die theoretischen Konzepte Goolishians, sondern auch seiner praktischen Arbeit!
Heute vor 85 Jahren, am 9. Mai 1924, wurde Harold A. Goolishian in Lowell, Massachusetts geboren. Goolishian, der am 10. November 1991 in Galveston, Texas, im Alter von 67 Jahren starb, war ein Pionier der Familientherapie und langjähriger Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie an der Medizinischen Fakultät Galveston der University of Texas. Gemeinsam mit Harlene Anderson und Paul Dell gründete er 1977 das das Galveston Family Institute in Texas. Sein und Harlene Andersons Konzept des„Problemdeterminierten Systems“, das hierzulande vor allem von Kurt Ludewig bekannt gemacht worden ist, hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Systemischen Therapie gespielt. Im Internet sind auf einer norwegischen website sieben Videos anzusehen, die der norwegische Psychotherapeut Steven Balmbra von einem Seminar mit Harry Goolishian im Januar 1988 gemacht hat, als dieser eine Woche mit Vorträgen und Workshops im Child and Adolescent Department des Nordland Psychiatric Hospital in Bodø, Nordnorwegen, zu Gast war. Insgesamt dauern die Videos fast 3,5 Stunden und geben einen Einblick nicht nur in die theoretischen Konzepte Goolishians, sondern auch seiner praktischen Arbeit!

 In diesem Jahr feiert der Carl-Auer-Verlag sein 20-jähriges Jubiläum. Aber wer war eigentlich Carl-Auer? Die wenigsten Menschen aus unserem Feld haben eine persönliche Erinnerung an ihn. Kein Wunder, seine Tätigkeit blühte im Verborgenen. Dennoch hat er sich hin und wieder Zeitzeugen offenbart. Zum Beispiel dem Altmeister Carlos Sluzki (Foto:
In diesem Jahr feiert der Carl-Auer-Verlag sein 20-jähriges Jubiläum. Aber wer war eigentlich Carl-Auer? Die wenigsten Menschen aus unserem Feld haben eine persönliche Erinnerung an ihn. Kein Wunder, seine Tätigkeit blühte im Verborgenen. Dennoch hat er sich hin und wieder Zeitzeugen offenbart. Zum Beispiel dem Altmeister Carlos Sluzki (Foto:  In ihrem Aufsatz Counseling Professionals as Agents of Promoting the Cultures of Peace diskutiert Ayoka Mopelola Olusakin (Foto:
In ihrem Aufsatz Counseling Professionals as Agents of Promoting the Cultures of Peace diskutiert Ayoka Mopelola Olusakin (Foto: 
 In zwei Jahren, so heißt es, werde die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten leben. New York war vor 50 Jahren die einzige Stadt der Erde mit mehr als 10 Millionen Bewohnern. Heute gibt es bereits 19 Mega-Cities diesen Ausmaßes. In einem Aufsatz für die C.A.P.-News, einem Online-Journal des Centrums für angewandte Politikforschung, schreibt Chloé Lachauer, es gehe in der Konsequenz darum, für die Zukunftsgesellschaft Lösungsansätze zu finden, mit diesen neuen Formen der Stadtlandschaften ökologisch, gesellschaftspolitisch und ökonomisch fertig zu werden. Bezeichnenderweise hat die größte Rückversicherung der Welt, die Münchner Rück, angesichts der neuesten Prognosen der Vereinten Nationen und anlässlich der UN-Konferenz für Katastrophenbegrenzung jüngst eine Studie publiziert, die die Mega-Cities der Zukunft als hoch komplexe Großrisiken betiteln, die nicht mehr versicherbar seien. Nicht nur ökologische Katastrophen werden vorausgesehen, sondern auch anarchische Gewaltzustände in den Städten, und eine Art Urban Sprawl im Sinne einer riesenhaften Slumisierung (Foto:
In zwei Jahren, so heißt es, werde die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten leben. New York war vor 50 Jahren die einzige Stadt der Erde mit mehr als 10 Millionen Bewohnern. Heute gibt es bereits 19 Mega-Cities diesen Ausmaßes. In einem Aufsatz für die C.A.P.-News, einem Online-Journal des Centrums für angewandte Politikforschung, schreibt Chloé Lachauer, es gehe in der Konsequenz darum, für die Zukunftsgesellschaft Lösungsansätze zu finden, mit diesen neuen Formen der Stadtlandschaften ökologisch, gesellschaftspolitisch und ökonomisch fertig zu werden. Bezeichnenderweise hat die größte Rückversicherung der Welt, die Münchner Rück, angesichts der neuesten Prognosen der Vereinten Nationen und anlässlich der UN-Konferenz für Katastrophenbegrenzung jüngst eine Studie publiziert, die die Mega-Cities der Zukunft als hoch komplexe Großrisiken betiteln, die nicht mehr versicherbar seien. Nicht nur ökologische Katastrophen werden vorausgesehen, sondern auch anarchische Gewaltzustände in den Städten, und eine Art Urban Sprawl im Sinne einer riesenhaften Slumisierung (Foto:  Die Verbindung von Bioethik und Pädagogik spielt in den momentanen Diskursen zur Reproduktionstechnologie keine zentrale Rolle. Alex Aßmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz und neuer systemagazin-Autor, hat sich aber in seinem„Plädoyer für eine Debatte“ über Bioethik Posthumanismus Pädagogik genau unter diesem Gesichtspunkt mit der Frage auseinandergesetzt:„Wollen wir wirklich, dass der Nachwuchs so gerät, wie wir ihn uns gewünscht hatten?“. In seinem Originalbeitrag für die
Die Verbindung von Bioethik und Pädagogik spielt in den momentanen Diskursen zur Reproduktionstechnologie keine zentrale Rolle. Alex Aßmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz und neuer systemagazin-Autor, hat sich aber in seinem„Plädoyer für eine Debatte“ über Bioethik Posthumanismus Pädagogik genau unter diesem Gesichtspunkt mit der Frage auseinandergesetzt:„Wollen wir wirklich, dass der Nachwuchs so gerät, wie wir ihn uns gewünscht hatten?“. In seinem Originalbeitrag für die