Am 28.5. berichtete systemagazin über die merkwürdige Praxis des JusProg-Projektes,„nach bestem Wissen und Gewissen“ webseiten als jugendgefährdend auf eine„Negativ-Liste“ zu setzen, die Kinder und Jugendliche vor Sex und Gewalt schützen soll. Wie die TAZ recherchierte, stellte sich heraus, dass bei der unter anderem von www.Bild.de und„Berlin intim
clever poppen!“ unterstützen Seiten auch websites wie die der TAZ und der Grünen als jugendgefährdend eingestuft worden sind. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Seiten nicht nach bestem Wissen und Gewissen von angeblichen Fachleuten indiziert werden, sondern offensichtlich von Suchrobotern, die natürlich einen speziellen Suchauftrag haben. Neugierig geworden, habe ich eine Recherche bzgl. des systemagazins unternommen und herausbekommen, was ich schon geahnt hatte: diese Seite enthält soviel Sex und Gewalt, dass sie Kindern und Jugendlichen nicht zuzumuten ist. Die sollen sich dann lieber an www.Bild.de halten.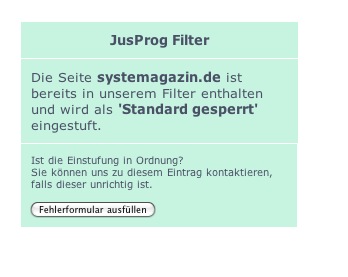
1. Juni 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare


 An der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) in Salzburg nimmt heute, am 1. Juni dieses Jahres das Institut für Synergetik und Psychotherapieforschung offiziell den Forschungsbetrieb auf. Es wird geleitet von Günter Schiepek (Foto). Mit dieser Initiative ist das erste Universitätsinstitut eingerichtet, das gesondert der Therapieforschung aus einer systemischen Sicht gewidmet ist. Das theoretische Fundament bilden dabei die Synergetik und die Theorien der Selbstorganisation. Auf solcher Basis gilt Psychotherapie als prozessuales Schaffen von Bedingungen für die Möglichkeit von Ordnungs-Ordnungs-Übergängen zwischen Kognitions-Emotions-Verhaltens-Mustern eines bio-psycho-sozialen Systems in einem (als Psychotherapie definierten) professionellen Kontext. Wie das, was diese Beschreibung zu bündeln versucht, sich im Alltag messen, einschätzen und prognostisch nutzbar machen lässt, ist Schwerpunkt der Arbeit des Instituts. Die dazu bereits entwickelten Verfahren des Real Time Monitoring und des Synergetic Navigation System dienen dazu, charakteristische zeitliche Muster von Veränderungsprozessen zu identifizieren. Neben Psychotherapie sind weitere Anwendungsbereiche in Planung, etwa Organisationsentwicklung und Management. Eine umfassende Kooperation zwischen einer Vielzahl von Kliniken und Institutionen ist europaweit eingestielt.
An der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) in Salzburg nimmt heute, am 1. Juni dieses Jahres das Institut für Synergetik und Psychotherapieforschung offiziell den Forschungsbetrieb auf. Es wird geleitet von Günter Schiepek (Foto). Mit dieser Initiative ist das erste Universitätsinstitut eingerichtet, das gesondert der Therapieforschung aus einer systemischen Sicht gewidmet ist. Das theoretische Fundament bilden dabei die Synergetik und die Theorien der Selbstorganisation. Auf solcher Basis gilt Psychotherapie als prozessuales Schaffen von Bedingungen für die Möglichkeit von Ordnungs-Ordnungs-Übergängen zwischen Kognitions-Emotions-Verhaltens-Mustern eines bio-psycho-sozialen Systems in einem (als Psychotherapie definierten) professionellen Kontext. Wie das, was diese Beschreibung zu bündeln versucht, sich im Alltag messen, einschätzen und prognostisch nutzbar machen lässt, ist Schwerpunkt der Arbeit des Instituts. Die dazu bereits entwickelten Verfahren des Real Time Monitoring und des Synergetic Navigation System dienen dazu, charakteristische zeitliche Muster von Veränderungsprozessen zu identifizieren. Neben Psychotherapie sind weitere Anwendungsbereiche in Planung, etwa Organisationsentwicklung und Management. Eine umfassende Kooperation zwischen einer Vielzahl von Kliniken und Institutionen ist europaweit eingestielt. „Man kann nicht unschuldig bleiben. Die Theorie hat nicht das letzte Wort. Wenn sie als Kommunikation Erfolg hat, verändert sie die Gesellschaft, die sie beschrieben hatte; verändert damit ihren Gegenstand und trifft danach nicht mehr zu. So hat die sozialistische Bewegung zu einer Marktunabhängigkeit der Arbeitspreise geführt – eine Tatsache, mit der wir nun leben müssen. So hat die Partizipationsbewegung der 68er, soweit sie sich auswirken konnte, zu riesigen Partizipationsbürokratien geführt und damit zu einem immensen Zuwachs an organisierten Entschuldigungen dafür, daß nichts geschieht, – einer Tatsache, mit der wir nun leben müssen. Die Wirklichkeit sieht anders aus als die Theorie, die sie herbeiführen wollte. Was ist aus dieser Affäre zu lernen? Zunächst und vor allem:„Die“ Gesellschaft hat keine Adressen. Was man von ihr verlangen will, muß man an Organisationen adressieren. (
) Auf der Ebene der theoretischen Beschreibungen muß man alledem entnehmen, daß es keinen Standpunkt außerhalb der Gesellschaft und in moralischen Dingen keine unschuldigen Positionen gibt, von denen aus man die Gesellschaft„kritisch“ beschreiben und Vorwürfe lancieren könnte. Wir haben keine Labyrinththeorie, die erforschen und dann voraussagen könnte, wie die Ratten laufen. Wir selbst sind die Ratten und können bestenfalls versuchen, im Labyrinth eine Position zu finden, die vergleichsweise bessere Beobachtungsmöglichkeiten bietet. Eine Gesellschaftsbeschreibung ist immer eine Beschreibung, die den Beschreiber selbst einbeziehen muß“ (aus:
„Man kann nicht unschuldig bleiben. Die Theorie hat nicht das letzte Wort. Wenn sie als Kommunikation Erfolg hat, verändert sie die Gesellschaft, die sie beschrieben hatte; verändert damit ihren Gegenstand und trifft danach nicht mehr zu. So hat die sozialistische Bewegung zu einer Marktunabhängigkeit der Arbeitspreise geführt – eine Tatsache, mit der wir nun leben müssen. So hat die Partizipationsbewegung der 68er, soweit sie sich auswirken konnte, zu riesigen Partizipationsbürokratien geführt und damit zu einem immensen Zuwachs an organisierten Entschuldigungen dafür, daß nichts geschieht, – einer Tatsache, mit der wir nun leben müssen. Die Wirklichkeit sieht anders aus als die Theorie, die sie herbeiführen wollte. Was ist aus dieser Affäre zu lernen? Zunächst und vor allem:„Die“ Gesellschaft hat keine Adressen. Was man von ihr verlangen will, muß man an Organisationen adressieren. (
) Auf der Ebene der theoretischen Beschreibungen muß man alledem entnehmen, daß es keinen Standpunkt außerhalb der Gesellschaft und in moralischen Dingen keine unschuldigen Positionen gibt, von denen aus man die Gesellschaft„kritisch“ beschreiben und Vorwürfe lancieren könnte. Wir haben keine Labyrinththeorie, die erforschen und dann voraussagen könnte, wie die Ratten laufen. Wir selbst sind die Ratten und können bestenfalls versuchen, im Labyrinth eine Position zu finden, die vergleichsweise bessere Beobachtungsmöglichkeiten bietet. Eine Gesellschaftsbeschreibung ist immer eine Beschreibung, die den Beschreiber selbst einbeziehen muß“ (aus: 






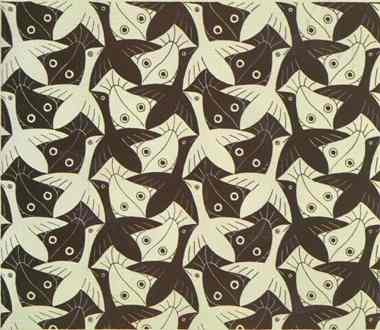
 In diesem schönen Beitrag aus dem Jahre 2005 für die Zeitschrift„Organization Science“ betonen die Organisationsforscher Karl Weick (Foto: University of Michigan), Kathleen M. Sutcliff und David Obstfeld die Bedeutung, die die Hervorbringung von Sinn nicht nur für Organisationen hat, sondern für alles organisationales Handeln schlechthin. Ohne die Schaffung von Sinn keine Identität und keine Entwicklung von Organisationen, ungeachtet aller damit verbundenen emotionalen und machtbezogenen Probleme. Ein Schlüsseltext für alle, die sich mit Organisationen befassen:„Sensemaking involves turning circumstances into a situation that is comprehended explicitly in words and that serves as a springboard into action. In this paper we take the position that the concept of sensemaking fills important gaps in organizational theory. The seemingly transient nature of sensemaking belies its central role in the determination of human behavior, whether people are acting in formal organizations or elsewhere. Sensemaking is central because it is the primary site where meanings materialize that inform and constrain identity and action. The purpose of this paper is to take stock of the concept of sensemaking. We do so by pinpointing central features of sensemaking, some of which have been explicated but neglected, some of which have been assumed but not made explicit, some of which have changed in significance over time, and some of which have been missing all along or have gone awry. We sense joint enthusiasm to restate sensemaking in ways that make it more future oriented, more action oriented, more macro, more closely tied to organizing, meshed more boldly with identity, more visible, more behaviorally defined, less sedentary and backward looking, more infused with emotion and with issues of sensegiving and persuasion. These key enhancements provide a foundation upon which to build future studies that can strengthen the sensemaking perspective“
In diesem schönen Beitrag aus dem Jahre 2005 für die Zeitschrift„Organization Science“ betonen die Organisationsforscher Karl Weick (Foto: University of Michigan), Kathleen M. Sutcliff und David Obstfeld die Bedeutung, die die Hervorbringung von Sinn nicht nur für Organisationen hat, sondern für alles organisationales Handeln schlechthin. Ohne die Schaffung von Sinn keine Identität und keine Entwicklung von Organisationen, ungeachtet aller damit verbundenen emotionalen und machtbezogenen Probleme. Ein Schlüsseltext für alle, die sich mit Organisationen befassen:„Sensemaking involves turning circumstances into a situation that is comprehended explicitly in words and that serves as a springboard into action. In this paper we take the position that the concept of sensemaking fills important gaps in organizational theory. The seemingly transient nature of sensemaking belies its central role in the determination of human behavior, whether people are acting in formal organizations or elsewhere. Sensemaking is central because it is the primary site where meanings materialize that inform and constrain identity and action. The purpose of this paper is to take stock of the concept of sensemaking. We do so by pinpointing central features of sensemaking, some of which have been explicated but neglected, some of which have been assumed but not made explicit, some of which have changed in significance over time, and some of which have been missing all along or have gone awry. We sense joint enthusiasm to restate sensemaking in ways that make it more future oriented, more action oriented, more macro, more closely tied to organizing, meshed more boldly with identity, more visible, more behaviorally defined, less sedentary and backward looking, more infused with emotion and with issues of sensegiving and persuasion. These key enhancements provide a foundation upon which to build future studies that can strengthen the sensemaking perspective“