 Unter diesem Titel haben Ariane Bentner und Marie Krenzin im vergangenen Jahr eine Sammlung von Aufsätzen bei Vandenhoeck & Ruprecht veröffentlicht. Rezensent Klaus Schenck:„Das Buch »Erfolgsfaktor Intuition« ist ein Kaleidoskop: eine facettenreiche Zusammenstellung von Einsichten in Coachingprozesse und die Rolle von Intuition darin. In sieben Kapiteln versucht es eine Abgrenzung von Coaching zur Psychotherapie, beleuchtet die Vielfalt der Definitionen von Intuition und die Frage nach ihrer Lern- und Trainierbarkeit, untersucht mögliche Einflüsse der eigenen Geschwisterposition auf das Verhalten von Führungskräften und wie sich Coaching als Lernformat in der systemisch-lösungsorientierten Einzelberatung nutzen lässt, stellt eine empirische Studie zum subjektiven Erleben von Führungskräften im Coaching vor und endet mit dem Praxisbeispiel einer komplexen Strukturaufstellung. Auch wenn zwischen den Facetten natürlich Fragen offen bleiben und die einzelnen Kapitel auch je nach Autorin sprachlich unterschiedlich ausgestaltet sind, kann sich die Lektüre sowohl für Coaches als auch für Führungskräfte lohnen. Erstere können womöglich ihre Intuition aktiver nutzen und Wirkungen auf Coaches aus deren Sicht weiter kennenlernen. Letztere können sich ein vielfältiges Bild von Coachingprozessen machen und damit besser einschätzen, ob es für sie nützlich werden kann, sich darauf einzulassen“
Unter diesem Titel haben Ariane Bentner und Marie Krenzin im vergangenen Jahr eine Sammlung von Aufsätzen bei Vandenhoeck & Ruprecht veröffentlicht. Rezensent Klaus Schenck:„Das Buch »Erfolgsfaktor Intuition« ist ein Kaleidoskop: eine facettenreiche Zusammenstellung von Einsichten in Coachingprozesse und die Rolle von Intuition darin. In sieben Kapiteln versucht es eine Abgrenzung von Coaching zur Psychotherapie, beleuchtet die Vielfalt der Definitionen von Intuition und die Frage nach ihrer Lern- und Trainierbarkeit, untersucht mögliche Einflüsse der eigenen Geschwisterposition auf das Verhalten von Führungskräften und wie sich Coaching als Lernformat in der systemisch-lösungsorientierten Einzelberatung nutzen lässt, stellt eine empirische Studie zum subjektiven Erleben von Führungskräften im Coaching vor und endet mit dem Praxisbeispiel einer komplexen Strukturaufstellung. Auch wenn zwischen den Facetten natürlich Fragen offen bleiben und die einzelnen Kapitel auch je nach Autorin sprachlich unterschiedlich ausgestaltet sind, kann sich die Lektüre sowohl für Coaches als auch für Führungskräfte lohnen. Erstere können womöglich ihre Intuition aktiver nutzen und Wirkungen auf Coaches aus deren Sicht weiter kennenlernen. Letztere können sich ein vielfältiges Bild von Coachingprozessen machen und damit besser einschätzen, ob es für sie nützlich werden kann, sich darauf einzulassen“
Zur vollständigen Rezension
27. August 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare

 «What is central to everything above, then, is the move away from the idea of speech communication as being a process of information transmission, of the speaker as a source of information, of speech being a common code into which one puts one‟s thoughts, and of listeners as simply being decoders who have to task of arriving at the speaker‟s thought. This model‟ of the communication process eradicates the role of two major aspects of the communication situation: (1) The spontaneous, living, expressive-responsiveness of our bodies, thus leaving listeners as passive listeners in this situation, the active role of the other in the process of speech communication is… reduced to a minimum (Bakhtin, 1986, p. 70). (2) The other, is the role of what I have called the determining surroundings‟ of our utterance, the (often invisible) surroundings which, in our being spontaneously responsive to them in the voicing of our utterances, on the one hand, give shape not only the intonational contours of our utterances, but also to their whole style, to our word choices, to the metaphors we use and so on. But which, on the other, orients us toward the place‟ of our utterances in our world, toward where they should be located or toward what aspect they are relevant, and toward where next we might we might go, i.e., their point what they are trying to construct‟ in speaking as they are. In other words, it is crucial to bring our words back from their free-floating‟ use whether it be in committee or seminar rooms, in psychotherapy, in strategic planning in businesses, on the internet, or in just general conversations in sitting rooms to their use within a shared set of determining surroundings. That is, it is crucial if we are to understand how the specific variability in a speaker‟s expressions are expressive both of his or her unique inner world‟, and of the unique point‟ he or she wants to express, to make, in relation to their world.» In:
«What is central to everything above, then, is the move away from the idea of speech communication as being a process of information transmission, of the speaker as a source of information, of speech being a common code into which one puts one‟s thoughts, and of listeners as simply being decoders who have to task of arriving at the speaker‟s thought. This model‟ of the communication process eradicates the role of two major aspects of the communication situation: (1) The spontaneous, living, expressive-responsiveness of our bodies, thus leaving listeners as passive listeners in this situation, the active role of the other in the process of speech communication is… reduced to a minimum (Bakhtin, 1986, p. 70). (2) The other, is the role of what I have called the determining surroundings‟ of our utterance, the (often invisible) surroundings which, in our being spontaneously responsive to them in the voicing of our utterances, on the one hand, give shape not only the intonational contours of our utterances, but also to their whole style, to our word choices, to the metaphors we use and so on. But which, on the other, orients us toward the place‟ of our utterances in our world, toward where they should be located or toward what aspect they are relevant, and toward where next we might we might go, i.e., their point what they are trying to construct‟ in speaking as they are. In other words, it is crucial to bring our words back from their free-floating‟ use whether it be in committee or seminar rooms, in psychotherapy, in strategic planning in businesses, on the internet, or in just general conversations in sitting rooms to their use within a shared set of determining surroundings. That is, it is crucial if we are to understand how the specific variability in a speaker‟s expressions are expressive both of his or her unique inner world‟, and of the unique point‟ he or she wants to express, to make, in relation to their world.» In: 


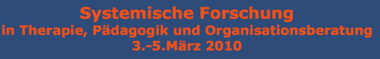

 „Ist die Neurobiologie der Psychotherapie eine Mode, die wieder verschwinden wird? Wird es sich Psychotherapie in Zukunft gefallen lassen müssen, ihre Effektivität über den Nachweis einer signifikanten neurobiologischen Veränderung in einem bildgebenden Verfahren zu dokumentieren? (
) Wird die Neurobiologie der Psychotherapie die Abschaffung der Schulenstreits in der Therapielandschaft vorantreiben oder werden nun erst die Grabenkämpfe darüber vom Zaune gebrochen, welche Therapie das Hirn besser verändert als die anderen? Werden wir Psychotherapeuten neuronengläubig und noch mehr als es bereits geschieht die sozial- und geisteswissenschaftliche Dimension vernachlässigen? Oder wird über die systemwissenschaftliche Zugangsweise der noch sehr lebendige simple Reduktionismus in der
„Ist die Neurobiologie der Psychotherapie eine Mode, die wieder verschwinden wird? Wird es sich Psychotherapie in Zukunft gefallen lassen müssen, ihre Effektivität über den Nachweis einer signifikanten neurobiologischen Veränderung in einem bildgebenden Verfahren zu dokumentieren? (
) Wird die Neurobiologie der Psychotherapie die Abschaffung der Schulenstreits in der Therapielandschaft vorantreiben oder werden nun erst die Grabenkämpfe darüber vom Zaune gebrochen, welche Therapie das Hirn besser verändert als die anderen? Werden wir Psychotherapeuten neuronengläubig und noch mehr als es bereits geschieht die sozial- und geisteswissenschaftliche Dimension vernachlässigen? Oder wird über die systemwissenschaftliche Zugangsweise der noch sehr lebendige simple Reduktionismus in der