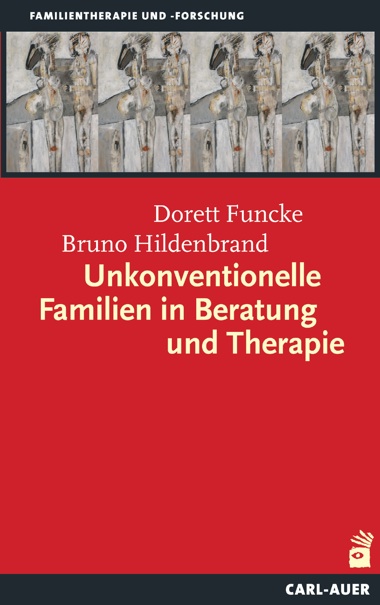26. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
25. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Seichtum für Alle? – Seichtum besteuern!
 Auf eine Post aus Perturbistan hat die geneigte Leserschaft lange warten müssen. Angesichts der Wahlen hat Lothar Eder aus Mannheim wieder zur Feder gegriffen und seine Wahlkampf-Pertubationen aufgeschrieben.„Jetz isses bald wieder soweit und ich weiß immer noch nicht, was ich wählen soll, sag ich zu Berta. Du? Nö, macht sie. In ein paar Tagen, am 27.9. ist Bundestagswahl. Der sogenannte Wahlkampf brummt vor sich hin und die rechte Wahllust bleibt dem Volke aus, so will es scheinen“
Auf eine Post aus Perturbistan hat die geneigte Leserschaft lange warten müssen. Angesichts der Wahlen hat Lothar Eder aus Mannheim wieder zur Feder gegriffen und seine Wahlkampf-Pertubationen aufgeschrieben.„Jetz isses bald wieder soweit und ich weiß immer noch nicht, was ich wählen soll, sag ich zu Berta. Du? Nö, macht sie. In ein paar Tagen, am 27.9. ist Bundestagswahl. Der sogenannte Wahlkampf brummt vor sich hin und die rechte Wahllust bleibt dem Volke aus, so will es scheinen“
Zur aktuellen Post aus Perturbistan
25. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Zitat des Tages: Arnold Retzer
 „Vielleicht könnte die Absolutheit der Liebe durch die Freundschaft relativiert und dadurch lebbarer werden. Der Gewissheitsillusion und der Ungewissheitsparanoia der Liebe könnte vielleicht mit dem gnädigen Kontingenzpotenzial (alles könnte auch ganz anders sein) geholfen werden. Man könnte sich dann fragen, ob man auch mit sich selbst befreundet sein möchte und warum oder warum auch gerade nicht. Dem Hinnehmen-Müssen der Liebe bzw. ihrer Abwesenheit könnte vielleicht mit dem Freien und Werben des Tunkönnens des Freundens geholfen werden, dem Autonomieverlust durch die Liebe bzw. den Identitätsversprechungen der Liebe wäre vielleicht durch das Recht auf Eigenes und die Selbsterzeugung durch die Freundschaft beizukommen. Es ließe sich dann fragen, wie das Verhältnis ist von gemeinsamem Lästern und Spotten über andere und anderes einerseits und der gemeinsamen Verständigung über ein gutes und schönes Leben andererseits. Der Substanzvorstellung der Liebe wäre vielleicht durch den Prozess der Freundschaft – das Freunden – beizukommen, und es ließen sich dann Fragen nach dem Verhältnis von Wohlwollen zu Wohltun stellen, und die Aufrichtigkeits- und Offenbarungsverpflichtung der Liebe wäre mit der Diskretion der Freundschaft zu mildern. Andererseits ließen sich aber auch vielleicht die verschärften marktwirtschaftlichen Kriege der Tauschgeschäftseskalationen einer Partnerschaft durch den einen oder anderen Freundschaftsbeweis von Geschenken entschärfen, und die spastische Verkrampfung auf das Recht ließe sich vielleicht durch die Fokussierung auf die Freiheit der Freundschaft, der Freunde und des Freundens lockern und entspannen. Man könnte sich dann selbst fragen, ob wir bei einem wichtigen Dissens mit unserem Partner wirklich glauben, dass unser Partner eine Berechtigung für seine Meinung hat. Es ließe sich vielleicht gar noch mancher freundschaftliche Streit und Kampf um die Paarbeziehung führen, wo sonst nur harmonische Stagnation herrscht, und es ließe sich vielleicht aber auch manch ein chronifizierter partnerschaftlicher Stellungskrieg in aller Freiheit beenden. Denn es scheint dann genauso gut, eine schlechte Freundschaft zu beenden wie um eine gute zu kämpfen“ (In: Freundschaft. Der dritte Weg zwischen Liebe und Partnerschaft? Familiendynamik 31, 2006, 149f.)
„Vielleicht könnte die Absolutheit der Liebe durch die Freundschaft relativiert und dadurch lebbarer werden. Der Gewissheitsillusion und der Ungewissheitsparanoia der Liebe könnte vielleicht mit dem gnädigen Kontingenzpotenzial (alles könnte auch ganz anders sein) geholfen werden. Man könnte sich dann fragen, ob man auch mit sich selbst befreundet sein möchte und warum oder warum auch gerade nicht. Dem Hinnehmen-Müssen der Liebe bzw. ihrer Abwesenheit könnte vielleicht mit dem Freien und Werben des Tunkönnens des Freundens geholfen werden, dem Autonomieverlust durch die Liebe bzw. den Identitätsversprechungen der Liebe wäre vielleicht durch das Recht auf Eigenes und die Selbsterzeugung durch die Freundschaft beizukommen. Es ließe sich dann fragen, wie das Verhältnis ist von gemeinsamem Lästern und Spotten über andere und anderes einerseits und der gemeinsamen Verständigung über ein gutes und schönes Leben andererseits. Der Substanzvorstellung der Liebe wäre vielleicht durch den Prozess der Freundschaft – das Freunden – beizukommen, und es ließen sich dann Fragen nach dem Verhältnis von Wohlwollen zu Wohltun stellen, und die Aufrichtigkeits- und Offenbarungsverpflichtung der Liebe wäre mit der Diskretion der Freundschaft zu mildern. Andererseits ließen sich aber auch vielleicht die verschärften marktwirtschaftlichen Kriege der Tauschgeschäftseskalationen einer Partnerschaft durch den einen oder anderen Freundschaftsbeweis von Geschenken entschärfen, und die spastische Verkrampfung auf das Recht ließe sich vielleicht durch die Fokussierung auf die Freiheit der Freundschaft, der Freunde und des Freundens lockern und entspannen. Man könnte sich dann selbst fragen, ob wir bei einem wichtigen Dissens mit unserem Partner wirklich glauben, dass unser Partner eine Berechtigung für seine Meinung hat. Es ließe sich vielleicht gar noch mancher freundschaftliche Streit und Kampf um die Paarbeziehung führen, wo sonst nur harmonische Stagnation herrscht, und es ließe sich vielleicht aber auch manch ein chronifizierter partnerschaftlicher Stellungskrieg in aller Freiheit beenden. Denn es scheint dann genauso gut, eine schlechte Freundschaft zu beenden wie um eine gute zu kämpfen“ (In: Freundschaft. Der dritte Weg zwischen Liebe und Partnerschaft? Familiendynamik 31, 2006, 149f.)
24. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Dialogue as collaborative action – Dialog als kollaboratives Handeln
Die aktuelle Ausgabe des Online-„Journals für Psychologie“ wird von Barbara Zielke & Thomas Slunecko mit dem Schwerpunktthema Dialog/Dialogizität herausgegeben. Mit dabei ist auch ein Originalbeitrag von Kenneth Gergen (in englischer Sprache). Im abstract heißt es:„Theorien sozialer Prozesse haben sich traditionell auf individualisierte Untersuchungseinheiten konzentriert, etwa auf die Person, die Gemeinschaft, die Organisation. Die Beziehungen zwischen den Einheiten werden dadurch marginalisiert und oft auf kausale Relationen reduziert. Nicht zuletzt aus diesem Grund erscheinen dialogische Prozesse bis heute nicht ausreichend theoretisch beleuchtet. Der vorliegende Beitrag analysiert zunächst einige vorliegende Theorien des Dialogs, um dann für die Konzeptualisierung des Dialogs als kollaborativem Handeln zu plädieren. Die Konstitution von Bedeutung wird dabei nicht dem Individuum und seinen Fähigkeiten, sondern dem kollaborativen Prozess selbst zugeschrieben. Die bedeutungsvollen (Sprech-)Handlungen der Dialogteilnehmenden sind mithin ko-konstitutiv und die Unterscheidung von Ursache und Wirkung wird obsolet. Der Beitrag diskutiert die Implikationen dieser Sichtweise unter Berücksichtigung kultureller und historischer Kontexte dialogischen Handelns“
Zum vollständigen Text
24. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Vorsprung von Schwarz-Geld schrumpft zusammen
23. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Zitat des Tages: Sigmund Freud
 Heute vor 70 Jahren starb in London Sigmund Freud (Foto: Wikimedia Commons), der nicht nur die Psychoanalyse begründet hat, sondern auch ein wunderbarer Schriftsteller war. Auch wenn viele seiner theoretischen Konzepte mittlerweile selbst der Vergänglichkeit anheimgefallen sind, ist die Lektüre seiner Arbeiten immer wieder ein Genuss. Ihm sei mit diesem Zitat des Tages, in dem es genau um diesen Wert des Vergänglichen geht, gedacht:„Der Vergänglichkeitswert ist ein Seltenheitswert in der Zeit. Die Beschränkung in der Möglichkeit des Genusses erhöht dessen Kostbarkeit. Ich erklärte es für unverständlich, wie der Gedanke an die Vergänglichkeit des Schönen uns die Freude an demselben trüben sollte. Was die Schönheit der Natur betrifft, so kommt sie nach jeder Zerstörung durch den Winter im nächsten Jahre wieder, und diese Wiederkehr darf im Verhältnis zu unserer Lebensdauer als eine ewige bezeichnet werden. Die Schönheit des menschlichen Körpers und Angesichts sehen wir innerhalb unseres eigenen Lebens für immer schwinden, aber diese Kurzlebigkeit fügt zu ihren Reizen einen neuen hinzu. Wenn es eine Blume giebt, welche nur eine einzige Nacht blüht, so erscheint uns ihre Blüte darum nicht minder prächtig. Wie die Schönheit und Vollkommenheit des Kunstwerks und der intellektuellen Leistung durch deren zeitliche Beschränkung entwertet werden sollte, vermochte ich ebensowenig einzusehen. Mag eine Zeit kommen, wenn die Bilder und Statuen, die wir heute bewundern, zerfallen sind, oder ein Menschengeschlecht nach uns, welches die Werke unserer Dichter und Denker nicht mehr versteht, oder selbst eine geologische Epoche, in der alles Lebende auf der Erde verstummt ist, der Wert all dieses Schönen und Vollkommenen wird nur durch seine Bedeutung für unser Empfindungsleben bestimmt, braucht dieses selbst nicht zu überdauern und ist darum von der absoluten Zeitdauer unabhängig“ (In: Vergänglichkeit. Der Text stammt aus: Das Land Goethes 19141916. Ein vaterländisches Gedenkbuch. Herausgegeben vom Berliner Goethebund. Stuttgart und Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1916. S. 3738.)
Heute vor 70 Jahren starb in London Sigmund Freud (Foto: Wikimedia Commons), der nicht nur die Psychoanalyse begründet hat, sondern auch ein wunderbarer Schriftsteller war. Auch wenn viele seiner theoretischen Konzepte mittlerweile selbst der Vergänglichkeit anheimgefallen sind, ist die Lektüre seiner Arbeiten immer wieder ein Genuss. Ihm sei mit diesem Zitat des Tages, in dem es genau um diesen Wert des Vergänglichen geht, gedacht:„Der Vergänglichkeitswert ist ein Seltenheitswert in der Zeit. Die Beschränkung in der Möglichkeit des Genusses erhöht dessen Kostbarkeit. Ich erklärte es für unverständlich, wie der Gedanke an die Vergänglichkeit des Schönen uns die Freude an demselben trüben sollte. Was die Schönheit der Natur betrifft, so kommt sie nach jeder Zerstörung durch den Winter im nächsten Jahre wieder, und diese Wiederkehr darf im Verhältnis zu unserer Lebensdauer als eine ewige bezeichnet werden. Die Schönheit des menschlichen Körpers und Angesichts sehen wir innerhalb unseres eigenen Lebens für immer schwinden, aber diese Kurzlebigkeit fügt zu ihren Reizen einen neuen hinzu. Wenn es eine Blume giebt, welche nur eine einzige Nacht blüht, so erscheint uns ihre Blüte darum nicht minder prächtig. Wie die Schönheit und Vollkommenheit des Kunstwerks und der intellektuellen Leistung durch deren zeitliche Beschränkung entwertet werden sollte, vermochte ich ebensowenig einzusehen. Mag eine Zeit kommen, wenn die Bilder und Statuen, die wir heute bewundern, zerfallen sind, oder ein Menschengeschlecht nach uns, welches die Werke unserer Dichter und Denker nicht mehr versteht, oder selbst eine geologische Epoche, in der alles Lebende auf der Erde verstummt ist, der Wert all dieses Schönen und Vollkommenen wird nur durch seine Bedeutung für unser Empfindungsleben bestimmt, braucht dieses selbst nicht zu überdauern und ist darum von der absoluten Zeitdauer unabhängig“ (In: Vergänglichkeit. Der Text stammt aus: Das Land Goethes 19141916. Ein vaterländisches Gedenkbuch. Herausgegeben vom Berliner Goethebund. Stuttgart und Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1916. S. 3738.)
23. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Netzwerktreffen Familienrat Family Group Conference 2009
Vom 17.-18.09.2009 fand das 3. bundesweite Netzwerktreffen zum Thema Familienrat Family Group Conference (FGC) in Stuttgart statt. Teilgenommen haben über 100 Teilnehmer/-innen aus dem Bundesgebiet. Vertreten waren u.a. Kollegen/-innen aus Stuttgart, Augsburg, München, Hamburg, Köln, Kassel, Dresden, Main-Taunus-Kreis, Frankfurt/Main, Berlin und Braunschweig. Familienrat/Family Group Conference ist keine neue zusätzliche sozialpädagogische Methode, sondern stellt ein Konzept mit einer neuen Haltung zur Hilfe dar, die umfassende Partizipation fördert und fordert, woraus eine andere Organisation von Entscheidungsfindungsprozessen resultiert. Andreas Hampe-Grosser und Heike Hör haben einen Tagungsbericht zum Netzwerkstreffen zu diesem vielversprechenden ressourcenorientierten Ansatz für das systemagazin verfasst.
Zum vollständigen Text
22. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Vorabdruck: Unkonventionelle Familien in Beratung und Therapie
„Familie ist heute kein brauchbares Wort mehr, denn es beschreibt eine Situation, die es heute nicht mehr gibt. Familien sind heute nicht mehr nur Kernfamilien, bestehend aus Vater, Mutter und Kind. Eine Einengung der Familie auf biologische Elternschaft grenzt viele andere Familien aus, in denen Stiefkinder leben. Familie und Haushalt fallen nicht unbedingt mehr zusammen. Auf der Grundlage dieser Thesen schlägt Karl Lenz, ein Paar- und Familiensoziologe, vor, den Familienbegriff durch den Begriff der persönlichen Beziehungen zu ersetzen. Das, was vorher Familie genannt wurde, wird nun so definiert: Es handelt sich um eine Form von Beziehung, in der (a) die Personen nicht austauschbar sind, (b) deren Beziehung auf absehbare Zeit fortbestehen wird, (c) die emotional aufeinander bezogen sind und in fortwährender Interaktion stehen, (d) die persönliches Wissen umeinander aufgebaut haben. Diese Definitionen unterscheiden sich auf den ersten Blick nur wenig voneinander. Die Unendlichkeitsfiktion bzw. die Vereinbarung, dass man der Liebesbeziehung kein Verfallsdatum setzen möchte, auch, dass man die Eltern-Kind-Beziehung nicht aufzukündigen gedenkt, nicht heute und nicht in der Zukunft, teilen beide Definitionen. Auch die persönliche Unersetzbarkeit gilt nicht als überholt. Trennung und Scheidung sind auch in der moderneren Definition nicht einfach hinzunehmende Tatsachen, sondern Katastrophen. Auch die in der älteren Familiensoziologie betonten Solidaritätsformen der affektiven, der erotischen und der unbedingten Solidarität werden im Begriff der persönlichen Beziehungen nicht aufgegeben. Dass jede auf Dauer angelegte Beziehung zu einem persönlichen, im Lauf der Zeit angehäuften Fundus an Wissen, besser gesagt: zu einer gemeinsamen Geschichte führt, wird weder hier noch dort in Zweifel gezogen. Worin also unterscheiden sich die beiden Konzepte? Sie unterscheiden sich in zwei wesentlichen Elementen: (1) In der Definition der persönlichen Beziehungen entfällt die biologische Elternschaft, und (2) es entfällt die Koppelung von Haushalt und Familie“ So beginnt das spannende erste Kapitel eines Buches, das Dorett Funcke gemeinsam mit Bruno Hildenbrand, systemisch interessierten Lesern längst und gut bekannt, in zu erwartender Qualität verfasst hat und in diesen Tagen im Carl-Auer-Verlag erscheint. systemagazin bringt das ganze Kapitel als Vorabdruck.
Zum vollständigen Text geht es hier
21. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung ist nicht die Vereinigung der deutschen Psychotherapeuten
Einige Presseberichte über die Todesfälle während einer psychotherapeutischen Sitzung in Berlin-Hermsdorf und die darin berichteten Statements des Psychotherapeuten Weidhaas können dieses Missverständnis nahelegen, zumal Hans-Jochen Weidhaas in einer Zeitung sogar als stellvertretender Vorsitzender der Bundes-Psychotherapeuten-Kammer vorgestellt wird.„’Bei der Gruppenssitzung handelte es sich um eine sogenannte ‚psycholytische Therapie‘. ‚Eine Psycholyse, wie sie der Hermsdorfer Arzt in seiner Praxis angeboten hatte, ist explizit nicht zugelassen‘, so Hans-Jochen Weidhaas, stellvertretender Vorsitzender der Bundes-Psychotherapeuten-Kammer. Drogen seien ohnehin verboten. Bei einer kassenärztlichen Zulassung sei der Therapeut an die offiziellen Richtlinien gebunden, sagte Weidhaas. Und hier ist klar festgelegt, mit welchen Methoden beziehungsweise mit welchen Verfahren jemand Patienten behandeln darf. In Deutschland gebe es rund 250 Psychotherapieverfahren. Aber in der vertragsärztlichen Versorgung zugelassen sind davon nur drei: nämlich die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die Psychoanalyse. Vor diesem Hintergrund solle der Patient sicherstellen, dass der jeweilige Therapeut eine Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung hat, riet Weidhaas“ So berichtete der Kölner„Express“. Zu dieser bekannten Art, auf der Herdplatte aktueller Katastrophennachrichten sogleich ein eigenes Süppchen zu kochen, hat Gerd Böttcher in den Berliner Blättern für Psychoanalyse und Psychotherapie einen Kommentar verfasst, der mit freundlicher Erlaubnis auch hier erscheint:
„Die großenteils noch nicht aufgeklärten Todesfälle in einer auch psychotherapeutisch zugelassenen ärztlichen Praxis in Berlin haben für die Tageszeitungen einen hohen nachrichten- und verkaufspolitischen Wert. Fachleute werden angefragt, um solche Vorgänge zu kommentieren. Sie sind häufig zu schnell zu Deutungen bereit, ehe die Zusammenhänge wirklich geklärt sind. Naheliegend ist es, dass die Medien Fachleute befragen, die vorgeben, die gesamte Psychotherapeutenschaft
zu repräsentieren, wie es die Verbandsbezeichnung Deutsche Psychotherapeutenvereinigung suggeriert, (Suggerieren laut Duden: einen bestimmten den Tatsachen nicht entsprechenden Eindruck entstehen lassen) so dass dieser Verband schließlich sogar mit der Bundespsychotherapeutenkammer verwechselt wird. Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung ist aber nicht die Vereinigung der deutschen Psychotherapeuten, sondern ein Verband unter vielen Psychotherapeutenverbänden. Wer sich mit solchem Repräsentationsanspruch anbietet, gerät häufig in Gefahr, mit der Nachrichtenkommentierung zugleich sein eigenes Anliegen zu verkaufen, nämlich die drei vertragsärztlich zugelassenen Psychotherapieverfahren unter rund 250 nicht zugelassenen Verfahren auch als allein berufsethisch vertretbare und wissenschaftlich anerkannte Verfahren gelten zu lassen. Der dahinter verborgene besitzstandswahrende Wissenschaftseklektizismus wird dabei selten erkannt. Immerhin könnte die verfahrenseinschränkende Regulierungshartnäckigkeit in der gesetzlichen Krankenversorgung durch Gesetzgeber, Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen das Feld unkontrollierter Psychotherapieverfahren erst ermöglichen. Die Unheilsmeldung von Berlin-Hermsdorf provoziert schnelle distanzierende Verurteilung. Psychotherapeutische Ethik birgt aber auch die Möglichkeit der Geduld und Deutungsabstinenz, die nicht vorschnell anklagt, sondern zuerst verstehen will, was sich in Hermsdorf eigentlich ereignet hat“
Gerd Böttcher
Berliner Blätter für Psychoanalyse und Psychotherapie
www.bbpp.de
mit den Maillisten
http://de.groups.yahoo.com/group/psychotherapeuten/
http://de.groups.yahoo.com/group/psychoanalyse/
redaktion@bbpp.org
21. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Zitat des Tages: Roland Reichenbach
„Überredungsdefinitionen (persuasive definitions) sind Definitionen, die weniger bestimmen, eingrenzen und klären (was ihre Aufgabe wäre), als vielmehr mit emotional aufgeladenen Wörtern zu überzeugen trachten und so auf mehr oder weniger direkte, mehr oder weniger polemische Weise Eindeutigkeiten erzeugen, d.h. es handelt sich um Versuche, die Einstellungen und Gefühle der Adressaten in bestimmter Hinsicht zu bearbeiten und zu dirigieren. In Überredungsdefinitionen kommt die Kraft der guten und der bösen Wörter erst richtig zur Geltung. Je eindeutiger die emotionale Geladenheit der Wörter (sei es im positiven oder negativen Sinn), je mehr also das Pädagogenherz ergriffen oder aber abgestoßen ist, desto schwerer mag es ihm fallen, den strategischen Gebrauch der Sprache überhaupt noch zu erkennen. Vielmehr meint es dann wahrscheinlich, mit der moralischen Wirklichkeit und Wahrheit in ganz besonders engem Kontakt zu stehen. Daß Überredungsdefinitionen oft unauffällig daherkommen, gehört zu ihrer Variabilität und Stärke. Wenn beispielsweise Alternativ- und Privatschulen dadurch definiert werden, daß in ihnen scheinbar im Unterschied zu anderen, z.B. öffentlichen Schulen die »Achtung vor der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler im Zentrum steht«, oder wenn möglichst wenig »extrinsische« Motive, dafür aber um so mehr »intrinsische« Motive gestärkt, gefördert bzw. befriedigt oder wenn Schulen als »embryonale Gesellschaften« verstanden, Kinder schlicht als »anders« begriffen werden sollen (und so weiter und so fort), dann handelt es sich im besten Fall um pädagogische Slogans, die einerseits oft eine hohe Zustimmungsrate erheischen, andererseits aber definitorisch überhaupt nichts bedeuten außer eben, daß sie als Pseudodefinitionen Überredungskraft besitzen“ (In:„Aktiv, offen und ganzheitlich. Überredungsbegriffe treue Partner des pädagogischen Besserwissens“, parapluie no. 19 (sommer 2004). http://parapluie.de/archiv/worte/paedagogik/
)
20. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Matthias Richling: Schäuble schießt ab mit dem Leben
17. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Limits and Possibilities of the Postmodern Narrative Self
 Carmel Flaskas (Foto: newspaper.unsw.edu.au) hat vor einiger Zeit (1999) einen interessanten Aufsatz veröffentlicht, in dem sie sich mit der postmodernen und sozialkonstruktionistischen Idee des Selbst als eines relationalen Phänomens, das sich in den sozialen Narrativen offenbart, kritisch auseinandersetzt. Sie plädiert gegen diese Konzeption für eine theoretisch flexiblere Option, nach der das Selbst sowohl als relational als auch als autonom in dem Sinne betrachtet werden kann, dass es auch eine vom sozialen Diskurs unabhängige Basis hat, als„a sense of a physical and emotional being, an embodied self, an experience of the autonomous self“. Im abstract des Aufsatzes, der im Australian and New Zealand Journal of Family Therapy erschien, heißt es:„The task of theorising the self has been of little interest historically in systemic therapy, yet becomes more interesting in the postmodern turn to the narrative metaphor and social constructionist ideas. Within this frame, the self is theorised as relational, fluid, and existing in narrative. The postmodern narrative self counters modernist assumptions of self as an autonomous and fixed internal entity, and brings with it theory and practice possibilities. However, any theory also brings limits, and this paper explores the limits of the central ideas of the postmodern narrative self. Through questioning and discussion, an argument is made for holding a dialectic in our thinking about the relational and autonomous self, for acknowledging very real boundaries on the fluidity of self, and for thinking of narrative as one way of knowing self, rather than exclusively constituting the being of self“
Carmel Flaskas (Foto: newspaper.unsw.edu.au) hat vor einiger Zeit (1999) einen interessanten Aufsatz veröffentlicht, in dem sie sich mit der postmodernen und sozialkonstruktionistischen Idee des Selbst als eines relationalen Phänomens, das sich in den sozialen Narrativen offenbart, kritisch auseinandersetzt. Sie plädiert gegen diese Konzeption für eine theoretisch flexiblere Option, nach der das Selbst sowohl als relational als auch als autonom in dem Sinne betrachtet werden kann, dass es auch eine vom sozialen Diskurs unabhängige Basis hat, als„a sense of a physical and emotional being, an embodied self, an experience of the autonomous self“. Im abstract des Aufsatzes, der im Australian and New Zealand Journal of Family Therapy erschien, heißt es:„The task of theorising the self has been of little interest historically in systemic therapy, yet becomes more interesting in the postmodern turn to the narrative metaphor and social constructionist ideas. Within this frame, the self is theorised as relational, fluid, and existing in narrative. The postmodern narrative self counters modernist assumptions of self as an autonomous and fixed internal entity, and brings with it theory and practice possibilities. However, any theory also brings limits, and this paper explores the limits of the central ideas of the postmodern narrative self. Through questioning and discussion, an argument is made for holding a dialectic in our thinking about the relational and autonomous self, for acknowledging very real boundaries on the fluidity of self, and for thinking of narrative as one way of knowing self, rather than exclusively constituting the being of self“
Der Aufsatz ist online hier zu finden
16. September 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare
Denn unser ist die Kraft und die Herrlichkeit