„Als Basisoperation der Psyche nannte Luhmann das Bewusstsein. Das war nur konsequent aus seiner Sicht. Sich da an Husserl anzulehnen, lag nahe, auch weil auf diese Weise andere Theoreme Husserls eingewoben werden konnten, also etwa Husserls Sinnbegriff, sein Zeitbegriff und natürlich seine phänomenlogische Herangehensweise als solche. Wie also müsste ein alternativer Kandidat beschaffen sein, den man als Operationsmodus des psychischen Systems und damit als Ersatz für Bewusstsein einsetzen könnte? Nun, eins steht fest, »das Unbewusste« kann dieser Kandidat nicht sein, denn das hieße, nun umgekehrt auf Bewusstsein verzichten zu müssen und also das Kind mit dem Bade auszuschütten. Der Kandidat muss sich also dadurch auszeichnen, Bewusstes wie Unbewusstes miteinander verbinden bzw. übergreifen zu können. Im Deutschen gibt es einen Begriff, der eigentlich jede Art geistiger Zustände und Prozesse meint, wenn auch zugegebner Maßen in den meisten Fällen auf Bewusstsein zielt. Dieser Begriff ist der des Erlebens. Schließlich sagen wir nicht, »ich habe das und das bewusstet«. Wir sagen: »Ich habe das und das erlebt.« Der Begriff schließt also Bewusstsein ein und nicht aus. Aber er legt sich nicht auf Bewusstsein fest. Wenn wir zu jemanden sagen: »Offensichtlich habe ich das als sehr unangenehm erlebt, sonst hätte ich nicht so brüsk reagiert«, dann heißt das, dass wir uns selbst manchmal klar darüber werden können, dass uns nicht immer alle Aspekte unseres Erlebens auch unmittelbar bewusst sind. Das ist kein sehr strenger Begriff des Unbewussten, aber uns reicht hier ja ein »door opener«“ (In:„Das Unbewusste − ein psychologisches Unding? Ein blinder Fleck Luhmanns und wie man ihn aufhellt“. Vortrag gehalten in Hamburg am 4.9.2006 im Institut für systemische Studien)
9. Oktober 2009
von Tom Levold
Keine Kommentare







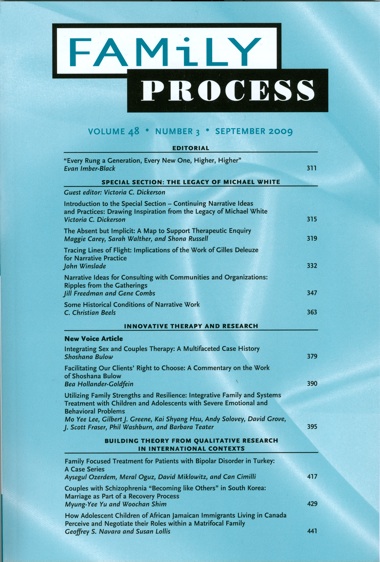

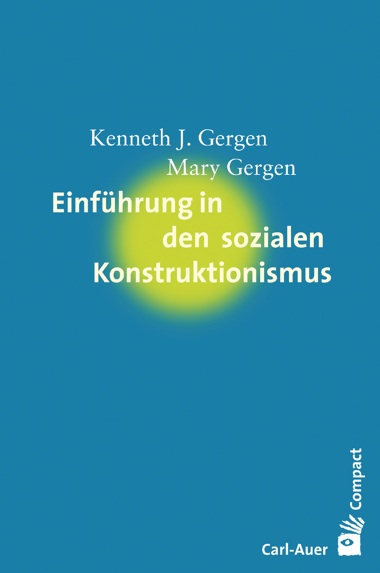
 „Wer da glaubt, die ursprüngliche causa movens des Wählers sei politisches Interesse, sei die ernste Sorge um die Verwaltung des Vaterlandes, der irrt. Das Parteigefühl ist in fast allen Fällen erst nachträglich als Beweggrund zum Wählen eingeschoben. Aber soviel Selbstpsychologe ist der Staatsbürger nicht, um zu erkennen, daß er in der Wahrung seiner vornehmsten Rechte kleinlicher Eitelkeit folgt. Er konstruiert erst aus der Handlung, die er gern tut, das Motiv, das ihm diese Handlung erst recht weihevoll erscheinen läßt. Es geht so wie Nietzsches bleichem Verbrecher, der den von ihm Ermordeten beraubt, um vor sich selbst einen Grund zum Mord zu haben. Der Ausfall der Wahl regt den Wähler kaum anders auf, als das Ende eines Wettrennens den, der auf ein bestimmtes Pferd gesetzt hat. Daß es sich bei dem Wettenden um Geld handelt, während sich der Wähler ideelle Interessen einbildet, macht keinen Unterschied. Denn erstens stehen alle Staatsbürgerideale auf materieller Grundlage und werden erst in der politischen Abstraktion ideell verklärt, und zweitens verquickt sich bei dem Startsetzer das Interesse an der riskierten Summe so sehr mit der Aufregung des Zuschauens, daß es sich zu einer wirklich begeisternden Spannung auswächst“ (In:
„Wer da glaubt, die ursprüngliche causa movens des Wählers sei politisches Interesse, sei die ernste Sorge um die Verwaltung des Vaterlandes, der irrt. Das Parteigefühl ist in fast allen Fällen erst nachträglich als Beweggrund zum Wählen eingeschoben. Aber soviel Selbstpsychologe ist der Staatsbürger nicht, um zu erkennen, daß er in der Wahrung seiner vornehmsten Rechte kleinlicher Eitelkeit folgt. Er konstruiert erst aus der Handlung, die er gern tut, das Motiv, das ihm diese Handlung erst recht weihevoll erscheinen läßt. Es geht so wie Nietzsches bleichem Verbrecher, der den von ihm Ermordeten beraubt, um vor sich selbst einen Grund zum Mord zu haben. Der Ausfall der Wahl regt den Wähler kaum anders auf, als das Ende eines Wettrennens den, der auf ein bestimmtes Pferd gesetzt hat. Daß es sich bei dem Wettenden um Geld handelt, während sich der Wähler ideelle Interessen einbildet, macht keinen Unterschied. Denn erstens stehen alle Staatsbürgerideale auf materieller Grundlage und werden erst in der politischen Abstraktion ideell verklärt, und zweitens verquickt sich bei dem Startsetzer das Interesse an der riskierten Summe so sehr mit der Aufregung des Zuschauens, daß es sich zu einer wirklich begeisternden Spannung auswächst“ (In: