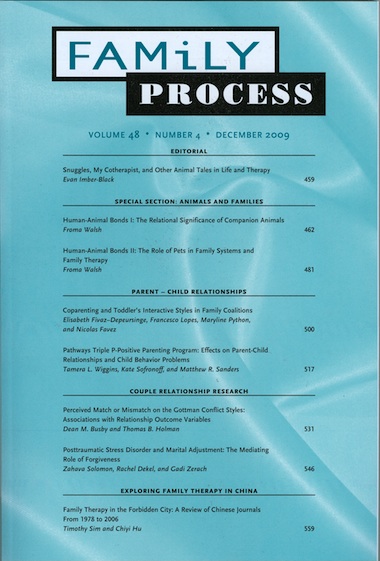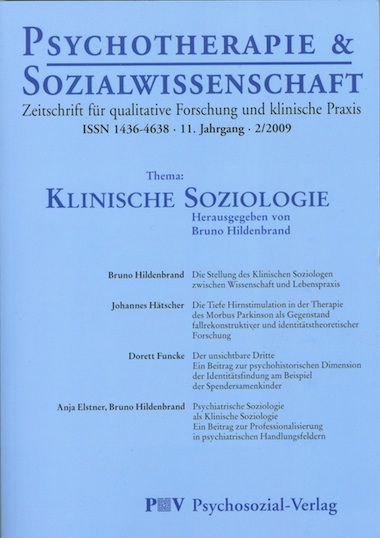„62. In den verschiedenen Relativismen werden die universalen Wahr-Falsch-Unterscheidungen entweder relativiert zu »wahr/falsch für
« oder ersetzt durch Unterscheidungen wie: »hinlänglich gerechtfertigt« vs. »nicht hinlänglich gerechtfertigt«, »viabel/nicht viabel«, »passend/nicht passend« oder »angemessen/unangemessen«.
„62. In den verschiedenen Relativismen werden die universalen Wahr-Falsch-Unterscheidungen entweder relativiert zu »wahr/falsch für
« oder ersetzt durch Unterscheidungen wie: »hinlänglich gerechtfertigt« vs. »nicht hinlänglich gerechtfertigt«, »viabel/nicht viabel«, »passend/nicht passend« oder »angemessen/unangemessen«.
63. Jeder relativistische Bezugrahmen muss zumindest soweit gefasst werden, dass in ihm Platz für Meinungsverschiedenheiten bleibt: dass also ein X für den Einen so sein kann und für den Anderen anders.
Es ist trivial, dass jeder relativistische Bezugrahmen Raum lassen muss für die Gedanken, die in ihm auftreten.
64. Ein Problem, das die Relativisten/Konstruktivisten nicht lösen: Wie geschieht der Übergang von der Konstruktion einer Welt-1 zu ihrer Interpretation?
Die Unbestimmtheit des Übergangs ermöglicht es im Konfliktfall, etwaige Gegenauffassungen entweder als falsch, aber zum Framework gehörig, zu diskreditieren – das hätte die unliebsame Konsequenz, dass das Framework wahre und falsche Auffassungen vereint – oder die Gegenposition als falsch in ein anderes Framework zu verweisen, womit sie aufhört, Gegenposition zu sein.
Die erste Möglichkeit führt zur Frage, wie überhaupt vom Framework aus noch zwischen wahren und falschen Beschreibungen unterschieden werden kann. Die zweite Möglichkeit kann nicht uneingeschränkt realisiert werden, sonst verliert der Relativismus/die relativistische Welt-1 jeden Halt: Wenn in einer Welt-1 nur konsensuelle Auffassungen möglich sind, dann entspricht jede konfligierende Auffassung einer anderen Welt und für Konflikte ist kein Platz.
65. Auch der radikalste Relativismus/Konstruktivismus macht Halt vor einer extremen Vorgangsweise derart, dass durch unser Reden ständig »parallel« dazu Objekte oder gar Welten hervorgebracht werden.
Eine solche halt-lose Position, in der jeder Zungenschlag und Augenblick ein neues Versum hervorbringt, würde sogar den Homo-mensura-Satz (und jeden Solipsismus) überbieten.
Eine Vorgangsweise, die weder die Resistenz eines »Ich« noch anderer Objekte gegen Beschreibungen anerkennen würde, hätte kein Maß und kein Ziel.
66. Der Homo-mensura-Satz bestimmt den Menschen zum Kriterium für die Dinge – wenn schon nicht, dass sie sind, so doch zumindest, wie sie sind.
Der Mensch als Kriterium und Instanz ist dem Relativismus entzogen.
Um als Instanz über das Sein oder zumindest das So-Sein der Dinge urteilen zu können, muss der Mensch eine Identität über den momentanen Zustand hinaus besitzen, in dem sein Urteil fällt.
Er muss mehr sein als nur der Mensch-zum-Zeitpunkt-eines-Urteils.
Sein Urteil muss für ihn eine Gültigkeit über den Urteilsspruch hinaus haben, sonst könnte von einer Identität des Menschen nicht die Rede sein“ (In: Die Flucht aus der Beliebigkeit. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 2001, 58ff)
13. Januar 2010
von Tom Levold
Keine Kommentare


 Thomas
Thomas