28. Januar 2010
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Heute wäre Don D. Jackson, einer der wichtigsten Pioniere der Familientherapie, Psychiater und Gründer des Mental Research Institute in Palo Alto, 90 Jahre alt geworden. Er starb viel zu früh, einen Tag nach seinem 48. Geburtstag, am 29.1.1968. Auf der„Don D. Jackson Memorial Conference“ hielt Nathan Ackerman eine Rede auf Jackson, in dem er die ebenso unorthodoxe wie unabhängige, aber auch ein bisschen einsame Position des Mavericks beschrieb, die Jackson innehatte:„If ever there was a maverick in psychiatry, Don was it. He was the near perfect epitome of all the complexities of a maverick. He had all the gifts, all the oddities, the strangenesses and the aloneness of a maverick. Wherever he went, he jolted his colleagues out of their comfort and complacency and they liked it. His scientific skepticism was his hallmark. Again and again, he asked,„How do you know?“;„Suppose we take the same problem, turn it inside out or upside down and re-examine it in a different way“. Yet he had no urge to rebel for the sake of rebelling. He entered the fray of scientific debate, armed with new observations, searching for new and more elegant syntheses. In the quest for truth, he was ever-ready to put new hypotheses to the test. In every sense, he was the living symbol of what Justice Douglas called„His majesty’s loyal opposition“. His very rebellion added to the strength, wisdom, and leadership of his elders. His soul was possessed; he had a mission and he pursued it to the end“ (Fam Proc 9, 1970, S. 117). Zum Gedenken an Don Jackson hier das Zitat des Tages von ihm, aus einem programmatischen Aufsatz„The Individual and the Larger Contexts“ aus dem Jahre 1967 (Fam Proc 6, s. 139):„We view symptoms, defenses, character structure, and personality as terms describing the individual’s typical interactions which occur in response to a particular interpersonal context, rather than as intra-psychic entities. Since the family is the most influential learning context, surely a more detailed study of family process will yield valuable clues to the etiology of such typical modes of interaction. Whether one thinks in terms of„role,“„tactics,“ or„behavior repertoire,“ it is obvious that the individual is shaped by, and in turn helps to shape, his family. This may not at first appear to be such a startlingly new approach but rather the most commonplace social psychology or, at best merely a shift of emphasis, an accentuation of ideas which are implicit in many of the great theories of contemporary behavioral science which refer to„interaction,“„relationships,“ etc. But it has been our experience, which I want to share with you, that when one begins to approach or even gather the data, it makes all the difference in the world exactly where the primary emphasis lies. One finds oneself almost immediately faced with certain conceptual watersheds, certain discontinuities between interactional data and individual theories“
Heute wäre Don D. Jackson, einer der wichtigsten Pioniere der Familientherapie, Psychiater und Gründer des Mental Research Institute in Palo Alto, 90 Jahre alt geworden. Er starb viel zu früh, einen Tag nach seinem 48. Geburtstag, am 29.1.1968. Auf der„Don D. Jackson Memorial Conference“ hielt Nathan Ackerman eine Rede auf Jackson, in dem er die ebenso unorthodoxe wie unabhängige, aber auch ein bisschen einsame Position des Mavericks beschrieb, die Jackson innehatte:„If ever there was a maverick in psychiatry, Don was it. He was the near perfect epitome of all the complexities of a maverick. He had all the gifts, all the oddities, the strangenesses and the aloneness of a maverick. Wherever he went, he jolted his colleagues out of their comfort and complacency and they liked it. His scientific skepticism was his hallmark. Again and again, he asked,„How do you know?“;„Suppose we take the same problem, turn it inside out or upside down and re-examine it in a different way“. Yet he had no urge to rebel for the sake of rebelling. He entered the fray of scientific debate, armed with new observations, searching for new and more elegant syntheses. In the quest for truth, he was ever-ready to put new hypotheses to the test. In every sense, he was the living symbol of what Justice Douglas called„His majesty’s loyal opposition“. His very rebellion added to the strength, wisdom, and leadership of his elders. His soul was possessed; he had a mission and he pursued it to the end“ (Fam Proc 9, 1970, S. 117). Zum Gedenken an Don Jackson hier das Zitat des Tages von ihm, aus einem programmatischen Aufsatz„The Individual and the Larger Contexts“ aus dem Jahre 1967 (Fam Proc 6, s. 139):„We view symptoms, defenses, character structure, and personality as terms describing the individual’s typical interactions which occur in response to a particular interpersonal context, rather than as intra-psychic entities. Since the family is the most influential learning context, surely a more detailed study of family process will yield valuable clues to the etiology of such typical modes of interaction. Whether one thinks in terms of„role,“„tactics,“ or„behavior repertoire,“ it is obvious that the individual is shaped by, and in turn helps to shape, his family. This may not at first appear to be such a startlingly new approach but rather the most commonplace social psychology or, at best merely a shift of emphasis, an accentuation of ideas which are implicit in many of the great theories of contemporary behavioral science which refer to„interaction,“„relationships,“ etc. But it has been our experience, which I want to share with you, that when one begins to approach or even gather the data, it makes all the difference in the world exactly where the primary emphasis lies. One finds oneself almost immediately faced with certain conceptual watersheds, certain discontinuities between interactional data and individual theories“

 Vor kurzem habe ich an dieser Stelle auf ein (schon länger zurückliegendes) Fernsehinterview mit Dirk Baecker hingewiesen, jetzt bin ich noch über ein interessantes Gespräch gestolpert, das Karin Fischer, meine Lieblingsredakteurin beim Deutschland-Radio, mit ihm über die Bedeutung der Medien und den gesellschaftlichen Wandel, der sich über den Gebrauch der Sprache über Schrift über den Buchdruck hin zur Computergesellschaft vollzogen hat und jeweils eigene soziale Möglichkeiten hervorbringt.
Vor kurzem habe ich an dieser Stelle auf ein (schon länger zurückliegendes) Fernsehinterview mit Dirk Baecker hingewiesen, jetzt bin ich noch über ein interessantes Gespräch gestolpert, das Karin Fischer, meine Lieblingsredakteurin beim Deutschland-Radio, mit ihm über die Bedeutung der Medien und den gesellschaftlichen Wandel, der sich über den Gebrauch der Sprache über Schrift über den Buchdruck hin zur Computergesellschaft vollzogen hat und jeweils eigene soziale Möglichkeiten hervorbringt.
 wir gratulieren Dir herzlich zur Verleihung des Deutschen Medienpreises 2009 (Foto: coinag.blogspot.com)! Als Menschen freuen wir uns natürlich besonders darüber, dass Du den Medienpreis bekommen hast, weil der Mensch bei Dir immer im Mittelpunkt des Denkens und Handelns steht. Und das auch noch berechenbar und verlässlich (auch wenn Du in den Medien nicht immer so gut rüberkommst). Schöner hätten wir es auch nicht formulieren können. Und Stefan Aust als Chef der Jury muss es schließlich wissen, weil er Dich so gut kennt. Wir kennen Dich ja nur aus dem Fernsehen, und deshalb können wir das ja nicht wissen (weil Du in den Medien nicht immer so gut rüberkommst). Trotzdem würden wir Dir natürlich auch den Medienpreis verleihen, denn Du hast einen echten Rekord gebrochen. 1980 hat nämlich der Gerhard Polt den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen und einen Medienrekord aufgestellt, weil er in der ganzen Sendung nix inhaltliches gesagt hat. Das fanden damals alle total sensationell! Dabei waren das nur 10 oder 20 Minuten. Das ist ja lachhaft! Schließlich sagt Du schon 10 oder 20 Monate lang gar nichts – und das ist (bei 30 Tagen pro Monat gerechnet) immerhin das 43.200fache der Zeit. Das soll Dir erst einmal jemand nachmachen. Natürlich kommt Dir da Dein DDR-Training zugute, da hat man ja 40 Jahre lang nichts sagen dürfen, trotzdem ist an Deinem Rekord nicht zu wackeln. Eigentlich hättest Du ja, wenn es sich nicht um große Kunst handeln würde, den Kleinkunstpreis 2010 verdient. Weil es aber keinen Großkunstpreis gibt, finden wir den Medienpreis voll in Ordnung. Allerdings nur unter einer Bedingung: Wenn Du bei der Preisverleihung auch nichts sagst.
wir gratulieren Dir herzlich zur Verleihung des Deutschen Medienpreises 2009 (Foto: coinag.blogspot.com)! Als Menschen freuen wir uns natürlich besonders darüber, dass Du den Medienpreis bekommen hast, weil der Mensch bei Dir immer im Mittelpunkt des Denkens und Handelns steht. Und das auch noch berechenbar und verlässlich (auch wenn Du in den Medien nicht immer so gut rüberkommst). Schöner hätten wir es auch nicht formulieren können. Und Stefan Aust als Chef der Jury muss es schließlich wissen, weil er Dich so gut kennt. Wir kennen Dich ja nur aus dem Fernsehen, und deshalb können wir das ja nicht wissen (weil Du in den Medien nicht immer so gut rüberkommst). Trotzdem würden wir Dir natürlich auch den Medienpreis verleihen, denn Du hast einen echten Rekord gebrochen. 1980 hat nämlich der Gerhard Polt den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen und einen Medienrekord aufgestellt, weil er in der ganzen Sendung nix inhaltliches gesagt hat. Das fanden damals alle total sensationell! Dabei waren das nur 10 oder 20 Minuten. Das ist ja lachhaft! Schließlich sagt Du schon 10 oder 20 Monate lang gar nichts – und das ist (bei 30 Tagen pro Monat gerechnet) immerhin das 43.200fache der Zeit. Das soll Dir erst einmal jemand nachmachen. Natürlich kommt Dir da Dein DDR-Training zugute, da hat man ja 40 Jahre lang nichts sagen dürfen, trotzdem ist an Deinem Rekord nicht zu wackeln. Eigentlich hättest Du ja, wenn es sich nicht um große Kunst handeln würde, den Kleinkunstpreis 2010 verdient. Weil es aber keinen Großkunstpreis gibt, finden wir den Medienpreis voll in Ordnung. Allerdings nur unter einer Bedingung: Wenn Du bei der Preisverleihung auch nichts sagst.
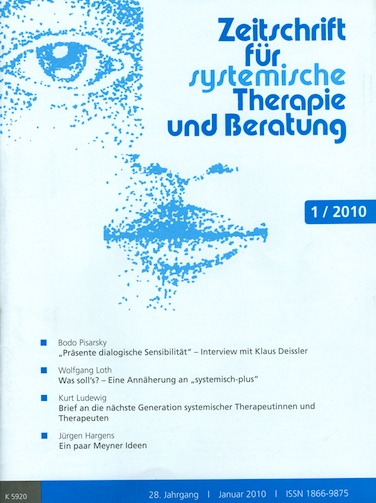
 Heute wäre Don D. Jackson, einer der wichtigsten Pioniere der Familientherapie, Psychiater und Gründer des Mental Research Institute in Palo Alto, 90 Jahre alt geworden. Er starb viel zu früh, einen Tag nach seinem 48. Geburtstag, am 29.1.1968. Auf der„Don D. Jackson Memorial Conference“ hielt Nathan Ackerman eine Rede auf Jackson, in dem er die ebenso unorthodoxe wie unabhängige, aber auch ein bisschen einsame Position des Mavericks beschrieb, die Jackson innehatte:„If ever there was a maverick in psychiatry, Don was it. He was the near perfect epitome of all the complexities of a maverick. He had all the gifts, all the oddities, the strangenesses and the aloneness of a maverick. Wherever he went, he jolted his colleagues out of their comfort and complacency and they liked it. His scientific skepticism was his hallmark. Again and again, he asked,„How do you know?“;„Suppose we take the same problem, turn it inside out or upside down and re-examine it in a different way“. Yet he had no urge to rebel for the sake of rebelling. He entered the fray of scientific debate, armed with new observations, searching for new and more elegant syntheses. In the quest for truth, he was ever-ready to put new hypotheses to the test. In every sense, he was the living symbol of what Justice Douglas called„His majesty’s loyal opposition“. His very rebellion added to the strength, wisdom, and leadership of his elders. His soul was possessed; he had a mission and he pursued it to the end“ (Fam Proc 9, 1970, S. 117). Zum Gedenken an Don Jackson hier das Zitat des Tages von ihm, aus einem programmatischen Aufsatz„The Individual and the Larger Contexts“ aus dem Jahre 1967 (Fam Proc 6, s. 139):„We view symptoms, defenses, character structure, and personality as terms describing the individual’s typical interactions which occur in response to a particular interpersonal context, rather than as intra-psychic entities. Since the family is the most influential learning context, surely a more detailed study of family process will yield valuable clues to the etiology of such typical modes of interaction. Whether one thinks in terms of„role,“„tactics,“ or„behavior repertoire,“ it is obvious that the individual is shaped by, and in turn helps to shape, his family. This may not at first appear to be such a startlingly new approach but rather the most commonplace social psychology or, at best merely a shift of emphasis, an accentuation of ideas which are implicit in many of the great theories of contemporary behavioral science which refer to„interaction,“„relationships,“ etc. But it has been our experience, which I want to share with you, that when one begins to approach or even gather the data, it makes all the difference in the world exactly where the primary emphasis lies. One finds oneself almost immediately faced with certain conceptual watersheds, certain discontinuities between interactional data and individual theories“
Heute wäre Don D. Jackson, einer der wichtigsten Pioniere der Familientherapie, Psychiater und Gründer des Mental Research Institute in Palo Alto, 90 Jahre alt geworden. Er starb viel zu früh, einen Tag nach seinem 48. Geburtstag, am 29.1.1968. Auf der„Don D. Jackson Memorial Conference“ hielt Nathan Ackerman eine Rede auf Jackson, in dem er die ebenso unorthodoxe wie unabhängige, aber auch ein bisschen einsame Position des Mavericks beschrieb, die Jackson innehatte:„If ever there was a maverick in psychiatry, Don was it. He was the near perfect epitome of all the complexities of a maverick. He had all the gifts, all the oddities, the strangenesses and the aloneness of a maverick. Wherever he went, he jolted his colleagues out of their comfort and complacency and they liked it. His scientific skepticism was his hallmark. Again and again, he asked,„How do you know?“;„Suppose we take the same problem, turn it inside out or upside down and re-examine it in a different way“. Yet he had no urge to rebel for the sake of rebelling. He entered the fray of scientific debate, armed with new observations, searching for new and more elegant syntheses. In the quest for truth, he was ever-ready to put new hypotheses to the test. In every sense, he was the living symbol of what Justice Douglas called„His majesty’s loyal opposition“. His very rebellion added to the strength, wisdom, and leadership of his elders. His soul was possessed; he had a mission and he pursued it to the end“ (Fam Proc 9, 1970, S. 117). Zum Gedenken an Don Jackson hier das Zitat des Tages von ihm, aus einem programmatischen Aufsatz„The Individual and the Larger Contexts“ aus dem Jahre 1967 (Fam Proc 6, s. 139):„We view symptoms, defenses, character structure, and personality as terms describing the individual’s typical interactions which occur in response to a particular interpersonal context, rather than as intra-psychic entities. Since the family is the most influential learning context, surely a more detailed study of family process will yield valuable clues to the etiology of such typical modes of interaction. Whether one thinks in terms of„role,“„tactics,“ or„behavior repertoire,“ it is obvious that the individual is shaped by, and in turn helps to shape, his family. This may not at first appear to be such a startlingly new approach but rather the most commonplace social psychology or, at best merely a shift of emphasis, an accentuation of ideas which are implicit in many of the great theories of contemporary behavioral science which refer to„interaction,“„relationships,“ etc. But it has been our experience, which I want to share with you, that when one begins to approach or even gather the data, it makes all the difference in the world exactly where the primary emphasis lies. One finds oneself almost immediately faced with certain conceptual watersheds, certain discontinuities between interactional data and individual theories“