
systemagazin gratuliert Michael B. Buchholz zum 60. Geburtstag! Mit ihm feiern wir heute einen der wichtigsten Impulsgeber für den aktuellen psychotherapeutischen Diskurs hierzulande. Nach einem Studium der Psychologie in Mainz und Heidelberg promovierte er 1980 bei Hermann Argelander mit einer Arbeit über die Psychoanalytische Methode und die Familientherapie. In der Zeit von 1979-1985 arbeitete er als Leiter einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, wechselte 1985 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Abteilung für Familientherapie der Universität Göttingen. Nach seiner Habilitation 1990 mit einer Venia Legendi für Soziologie übernahm er in der Zeit von 1990-1999 die Leitung der Forschungsabteilung am Krankenhaus für Psychosomatik und Psychotherapie Tiefenbrunn bei Göttingen sowie der familientherapeutischen Werkstatt in Tiefenbrunn. Seit 1999 ist er als Psychoanalytiker (seit 2001 auch als Lehranalytiker) in privater Praxis in Göttingen sowie als Gastprofessor an verschiedenen Universitäten tätig.
Michael Buchholz ist nicht nur Psychoanalytiker, sondern auch Familientherapeut der ersten Stunde und ein hervorragender Kenner der systemischen Literatur. Seine besondere Stärke liegt ohne Zweifel darin, die jeweiligen Ansätze auch gegen ihren Strich bürsten, Mainstream-Floskeln entlarven und intellektuelle Potentiale herauszuarbeiten zu können, die sich gerade aus der Überschreitung von Schulengrenzen ergeben. Mit seinen Psycho-Newslettern, von denen er im Auftrag der DGPT mittlerweile fast 80 verfasst hat und die mittlerweile drei im Psychosozial-Verlag erschienene Bände füllen, hat er in den letzten 8 Jahren über aktuelle Entwicklungen der Psychotherapieforschung, Diskussionen in Zeitschriften und neuere Bücher informiert und dabei einen gewaltigen Horizont an Themen, theoretischen Hintergründen, Einfällen und Verweisen aufgespannt. Wie nur wenige sonst verfügt Michael Buchholz als Psychologe und Sozialwissenschaftler über die dafür notwendige inhaltliche Reichweite und die entsprechende Verknüpfungskompetenz. Er ist ein Pfadfinder im besten Sinne des Wortes, der immer wieder neue Wege des Denkens und Reflektierens aufspürt. Dabei ist er ebenso unabhängig wie unbestechlich und unbeeindruckt von Ideologien und Dogmatiken, die sich auch unter Psychotherapeuten schnell breitmachen. Dass Michael Buchholz kein Funktionär und Vereinsmeier ist, hat seine Karriere nicht unbedingt gefördert, seinem Ruf als originellem und brillantem Denker und Forscher aber gewiss nicht geschadet. Mit seinen zahlreichen Büchern und Aufsätzen (z.B. zur Psychotherapie als Profession, zur Metapherntheorie und Psychotherapieforschung und nicht zuletzt dem großartigen dreibändigen, gemeinsam mit Günther Gödde herausgegebenen Mammutwerk über das Unbewusste) hat er nicht nur komplexe Themenbereiche einem größeren therapeutischen Publikum erschlossen, sondern dies immer aber auf eine Weise, die Neugier weckt und die eigene Begeisterung für das Lesen an jeder Stelle den Lesern mitteilt, vorausgesetzt, dass diese sich dem Abenteuer einer komplexen Lektüre aussetzen. Systemiker können hier lernen, dass eine interaktionsorientierte zeitgemäße Psychoanalyse sich nicht nur systemisch-konstruktivistischen Grundsätzen immer weiter annähert, sondern auch Fragestellungen und Forschungsprogramme anzubieten hat, mit denen sich auch SystemikerInnen beschäftigen sollten.
Lieber Michael, zum Geburtstag die herzlichsten Glückwünsche – verbunden mit der Hoffnung, dass Deine Schaffenskraft und Deine intellektuelle Leidenschaft auch weiterhin ihre so erfolgreiche Liaison aufrechterhalten und auch zukünftig ihre Wirkungen entfalten mögen.
Tom Levold
weitere Glückwünsche


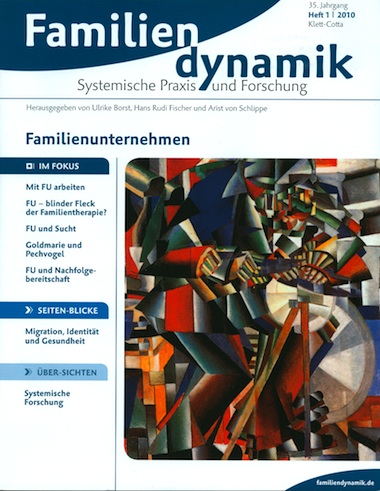
 In der Zeitschrift„Organisationsentwicklung“ hat Dirk Baecker 2005 einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er über Form und Medium der Führung in Organisationen schreibt und die Verbindung zu neueren netzwerktheoretischen Ansätzen knüpft. Das Manuskript dieses Beitrages ist im Internet veröffentlicht:„Der Knoten, den die Führung einer Organisation zugleich schnüren und lösen muss, besteht darin, dass die externen Sachverhalte, auf die sie intern verweisen muss, um interne Anschlussfragen der Entscheidungs- und Strategiefragen zu klären, immer schon intern konstruierte Sachverhalte sind. Hinzu kommt, dass die interne Konstruktion der externen Sachverhalte sich nur in der Auseinandersetzung mit der Umwelt der Organisation bewähren kann, ohne dass man je wüsste, ob man diese Umwelt zutreffend beschrieben hat und ob das, was sich bewährt, irgendetwas mit den eigenen Konstruktionen zu tun hat. Deswegen oszilliert die Führung einer Organisation zwischen Willkür und Ungewissheit, genauer noch: Sie schafft die Ungewissheit, die sie nur dank eigener Willkür bearbeiten kann, indem ihre eigene Willkür die Frage aufwirft, ob intern (Folgebereitschaft) und extern (Gelegenheiten) eine hinreichende Rechtfertigung dieser Willkür gegeben ist oder, alternativ, geschaffen werden kann. Die allgemeinste Form der Führung lässt sich danach bestimmen als Wiedereintritt der Unterscheidung zwischen Bestimmtheit und Unbestimmtheit auf der Seite der Bestimmtheit. Führung wird damit zur re-entry-Formel von Kommunikation auf der Seite der Bestimmtheit, wenn Kommunikation heißen darf, das Informations- und Mitteilungsverhalten an der Relation von Bestimmtem und Unbestimmtem zu orientieren, und wenn die Festlegung der Kommunikation auf etwas Bestimmtes als allgemeinste Form der Führung gelten darf. Diese allgemeine Form der Führung noch vor ihrer Spezifikation für organisierte oder andere Sozialsysteme lebt entscheidend, um nicht zu sagen: führend, davon, dass sie ihre eigene Festlegung im Kontext des Unbestimmten, der dazu mitgeführt werden muss, mit vorführt. Nur das ist Führung. Das schnürt den Knoten und das löst ihn“
In der Zeitschrift„Organisationsentwicklung“ hat Dirk Baecker 2005 einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er über Form und Medium der Führung in Organisationen schreibt und die Verbindung zu neueren netzwerktheoretischen Ansätzen knüpft. Das Manuskript dieses Beitrages ist im Internet veröffentlicht:„Der Knoten, den die Führung einer Organisation zugleich schnüren und lösen muss, besteht darin, dass die externen Sachverhalte, auf die sie intern verweisen muss, um interne Anschlussfragen der Entscheidungs- und Strategiefragen zu klären, immer schon intern konstruierte Sachverhalte sind. Hinzu kommt, dass die interne Konstruktion der externen Sachverhalte sich nur in der Auseinandersetzung mit der Umwelt der Organisation bewähren kann, ohne dass man je wüsste, ob man diese Umwelt zutreffend beschrieben hat und ob das, was sich bewährt, irgendetwas mit den eigenen Konstruktionen zu tun hat. Deswegen oszilliert die Führung einer Organisation zwischen Willkür und Ungewissheit, genauer noch: Sie schafft die Ungewissheit, die sie nur dank eigener Willkür bearbeiten kann, indem ihre eigene Willkür die Frage aufwirft, ob intern (Folgebereitschaft) und extern (Gelegenheiten) eine hinreichende Rechtfertigung dieser Willkür gegeben ist oder, alternativ, geschaffen werden kann. Die allgemeinste Form der Führung lässt sich danach bestimmen als Wiedereintritt der Unterscheidung zwischen Bestimmtheit und Unbestimmtheit auf der Seite der Bestimmtheit. Führung wird damit zur re-entry-Formel von Kommunikation auf der Seite der Bestimmtheit, wenn Kommunikation heißen darf, das Informations- und Mitteilungsverhalten an der Relation von Bestimmtem und Unbestimmtem zu orientieren, und wenn die Festlegung der Kommunikation auf etwas Bestimmtes als allgemeinste Form der Führung gelten darf. Diese allgemeine Form der Führung noch vor ihrer Spezifikation für organisierte oder andere Sozialsysteme lebt entscheidend, um nicht zu sagen: führend, davon, dass sie ihre eigene Festlegung im Kontext des Unbestimmten, der dazu mitgeführt werden muss, mit vorführt. Nur das ist Führung. Das schnürt den Knoten und das löst ihn“


