5. November 2010
von Tom Levold
Keine Kommentare
Witten. Am 25. 10.2010 wurde an der Privaten Universität Witten/Herdecke der Fachverband für Biografiearbeit e.V. (FaBiA) gegründet.
Der Fachverband hat sich zum Ziel gesetzt, Biografiearbeit in Deutschland im Bereich Praxis und Wissenschaft zu fördern und Qualitätsstandards zu entwickeln. Angeleitete, bewusste Biografiearbeit setzt Wissen und eine Haltung der Achtsamkeit voraus. Wer sich auf sie einlässt, setzt Prozesse in Gang, die das Leben verändern. Daher ist ein bestimmtes Maß an Professionalität zum Schutz des Gegenübers und zum Selbstschutz eine Notwendigkeit. Dem Fachverband kann beitreten, wer ein Hoch- oder Fachhochschulstudium oder eine gleichwertige Ausbildung, die in besonderer Weise zur Biografiearbeit befähigt, absolviert hat und ein Praxis- oder Forschungsfeld in dem er oder sie Biografiearbeit betreibt, nachweisen kann. Der Verband versteht sich als Forum zum Austausch der Fachleute und sucht den Dialog mit Einrichtungen und Instituten, in denen Biografiearbeit betrieben wird, sowie mit angrenzenden Fachgebieten.
Als Vorsitzende des Verbandes, der seinen Sitz in Kassel hat, wurde Herta Schindler (Systemische Lehrtherapeutin, Systemisches Institut Kassel) von den Gründungsmitgliedern gewählt. Ihre Stellvertreter/innen sind Dr. Almute Nischak (Ethnologin, systemische Familientherapeutin, Tübingen) und Thomas Schollas (Systemischer Therapeut und Supervisor, Kiel). Prof. Dr. Arist von Schlippe, wurde zum Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats gewählt. Im Herbst 2011 wird der Fachverband zu einer ersten Tagung mit dem Titel Biografiearbeit im Dialog nach Kassel einladen.
Der Begriff Biografiearbeit ist ein Sammelbegriff für viele verschiedene Formen professionell und wissenschaftlich unterstützter Erinnerungsarbeit. Dies geschieht zum einen im Kontext von Psychotherapie, aber auch in der Rekonstruktion von Lebensgeschichten im Rahmen von Projekten oder in der biografischen Forschung. Über die wissenschaftliche Biografieforschung hinaus spielt Biografiearbeit heute eine Rolle in zahlreichen Berufsfeldern, sei es im Bereich der Seniorenarbeit, in der Trauerbegleitung, in der sich ausweitenden Arbeit mit Pflegefamilien oder im Bereich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Im klinischen Bereich und in der therapeutischen Arbeit hilft sie bei der Suche nach der Entstehung und Bedeutung von Symptomen und dient zur Generierung von Ressourcen, die heilende Prozesse unterstützen. Das Gemeinsame all dieser Formen ist, dass sie sich mit den Geschichten befassen, die Menschen erzählen: Geschichten sind für Menschen das zentrale Ordnungsmuster, das sie ihr Leben als ein kohärentes Ganzes erfahren lässt, sagt Professor Arist von Schlippe, Inhaber des Lehrstuhls für Führung und Dynamik von Familienunternehmen an der Privaten Universität Witten/Herdecke und eines der Gründungsmitglieder.
Anders als noch im vergangenen Jahrhundert sind die Biografien von Menschen individueller und brüchiger geworden. Die Vielfalt der Lebensformen und Lebensweisen hat zugenommen. Was in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts überwiegend für Frauen zutraf, gilt jetzt auch beinahe durchgängig für Männer: Die Erwerbsbiografie der meisten Menschen in unserer westlichen Kultur ist von zahlreichen Wechseln und Zeiten der Arbeitslosigkeit geprägt. Die Notwendigkeit, sich selbst zu erfinden und die Erfahrungen des eigenen Lebens, insbesondere die Brüche, sinnvoll in das Ganze der Identität einzuordnen, ist heute notwendiger denn je. Dies gilt in nahezu allen Lebensphasen. Daher ist Biografiearbeit heute in den unterschiedlichsten Kontexten von großer existenzieller Bedeutung. Biografiearbeit bietet eine schöpferische Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben oder Aspekten davon, in der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft miteinander verknüpft werden. Sie wird sowohl von einzelnen Personen als auch von Personengruppen wahrgenommen. Subjekt der Biografiearbeit kann ein einzelner Mensch, eine Familie, ein Unternehmen, ein Ort und anderes mehr sein.
Fachverband für Biografiearbeit
c/o Systemisches Institut Kassel
Ludwig-Mond-Straße 45a
34121 Kassel
info@hertaschindler.de
www.FaBiA-eV.de (in Kürze)
 Nino Tomaschek hat bereits 2006 im Carl-Auer-Verlag ein Handbuch mit diesem Titel herausgegeben, das im vergangenen Jahr in zweiter Auflage erschienen ist. Es umfasst Beiträge prominenter AutorInnen, u.a. Roswita Königswieser, Oswald Neuberger, Andreas Bergknapp, Hans Rudi Fischer, Kurt Buchinger und Ruth Seliger. Karin Wisch hat vor einiger Zeit das Buch rezensiert und resümiert:„Das vorliegende Buch ist nicht nur ein Handbuch mit Anleitungen und Erfahrungsberichten, es ist auch ein Werkzeugkasten mit unterschiedlich komplexen Werkzeugen, um Veränderungsprozesse zu gestalten. Die oben beschriebenen Ansätze machen nur einen kleinen Teil des Handbuches aus. Das Buch ist erfrischend für erfahrene Systemiker, die sich Reflexionen und Anregungen im Alltag wünschen. Außerdem bietet es sprachliche Bilder und Formulierungen, um systemische Vorgänge in Veränderungsprozessen zu erklären und zu aktivieren“
Nino Tomaschek hat bereits 2006 im Carl-Auer-Verlag ein Handbuch mit diesem Titel herausgegeben, das im vergangenen Jahr in zweiter Auflage erschienen ist. Es umfasst Beiträge prominenter AutorInnen, u.a. Roswita Königswieser, Oswald Neuberger, Andreas Bergknapp, Hans Rudi Fischer, Kurt Buchinger und Ruth Seliger. Karin Wisch hat vor einiger Zeit das Buch rezensiert und resümiert:„Das vorliegende Buch ist nicht nur ein Handbuch mit Anleitungen und Erfahrungsberichten, es ist auch ein Werkzeugkasten mit unterschiedlich komplexen Werkzeugen, um Veränderungsprozesse zu gestalten. Die oben beschriebenen Ansätze machen nur einen kleinen Teil des Handbuches aus. Das Buch ist erfrischend für erfahrene Systemiker, die sich Reflexionen und Anregungen im Alltag wünschen. Außerdem bietet es sprachliche Bilder und Formulierungen, um systemische Vorgänge in Veränderungsprozessen zu erklären und zu aktivieren“
 Am Freitag, dem 12.11.2010, ist der Philosoph und Mitbegründer des radikalen Konstruktivismus, Ernst von Glasersfeld, in Massachusetts, seiner Wahlheimat, an einem Pankreas-Tumor gestorben. Das teilte der Philosoph Josef Mitterer in Wien mit, der den Nachlass von Glasersfelds verwalten wird (
Am Freitag, dem 12.11.2010, ist der Philosoph und Mitbegründer des radikalen Konstruktivismus, Ernst von Glasersfeld, in Massachusetts, seiner Wahlheimat, an einem Pankreas-Tumor gestorben. Das teilte der Philosoph Josef Mitterer in Wien mit, der den Nachlass von Glasersfelds verwalten wird ( Hans Lieb, im systemischen Feld durch zahlreiche Arbeiten zur Theorie und Praxis systemischer Theorie bekannt, hat im vergangenen Jahr einen Aufsatz über Krisenbewältigung geschrieben, dessen erster Teil„Krisenbewältigung als schöpferischer Prozess“ in systhema 1/2009 erschienen ist: hier„werden Kernmerkmale, Arten und potenzielle Inhalte von Krisen beschrieben mit einer sich normativ daraus ergebenden guten Krisenbewältigung. Es folgen Konsequenzen für Krisenintervention und Krisenbewältigung in Therapie und Beratung. Bei der Darstellung der Innenansichten von Krisen werden diese in Anlehnung an Verena Kast als potenziell schöpferische Prozesse verstanden. In diesen erweist sich die Begegnung mit darin enthaltenen primären Gefühlen als Ressource. Im zweiten Teil werden vier praktisch- empirisch ermittelte Krisenbewältigungstypen vorgestellt (schnelle Handler einsame Wölfe vernebelnde Differenzierer chronische Krisler). Deren Identifikationen haben sich sowohl in Selbstdiagnosen wie in Therapie und Beratung als nützlich erwiesen“
Hans Lieb, im systemischen Feld durch zahlreiche Arbeiten zur Theorie und Praxis systemischer Theorie bekannt, hat im vergangenen Jahr einen Aufsatz über Krisenbewältigung geschrieben, dessen erster Teil„Krisenbewältigung als schöpferischer Prozess“ in systhema 1/2009 erschienen ist: hier„werden Kernmerkmale, Arten und potenzielle Inhalte von Krisen beschrieben mit einer sich normativ daraus ergebenden guten Krisenbewältigung. Es folgen Konsequenzen für Krisenintervention und Krisenbewältigung in Therapie und Beratung. Bei der Darstellung der Innenansichten von Krisen werden diese in Anlehnung an Verena Kast als potenziell schöpferische Prozesse verstanden. In diesen erweist sich die Begegnung mit darin enthaltenen primären Gefühlen als Ressource. Im zweiten Teil werden vier praktisch- empirisch ermittelte Krisenbewältigungstypen vorgestellt (schnelle Handler einsame Wölfe vernebelnde Differenzierer chronische Krisler). Deren Identifikationen haben sich sowohl in Selbstdiagnosen wie in Therapie und Beratung als nützlich erwiesen“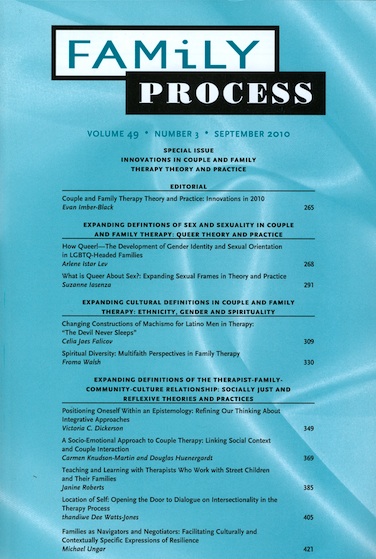
 Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Leserinnen und Leser, Unter dieser Überschrift plädiert der Allgemeinmediziner Harald Kamps (Foto: www.praxis-kamps.de) in einem schönen Artikel für die Berücksichtigung einer„dialogbasierten Medizin“ als notwendige Ergänzung zur„evidenzbasierten Medizin“. Der Artikel ist 2004 in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin erschienen (Ausg. 80, S. 438-442) und online zu lesen. Im abstract heißt es:„Sprachliche Bilder, Metaphern, die in dem Gespräch zwischen Arzt und Patient vorkommen, können zu einem besseren Verständnis der Krankengeschichte und des Behandlungsverlaufes beitragen. Metaphern können auch ein sprachliches Mittel sein, um Themen zuberühren, die in einer konkreten Sprache schwierig zu vermitteln sind: Tod, Trauer und Schmerzen. Metaphern im Arztgespräch können aus der Lebenswelt des Patienten geholt werden, aber auch aus der Wissenswelt der Medizin. Die medizinische Sprache wird geprägt von Metaphern aus Krieg und Technik. Der angelsächsische Begriff„narrative based medicine“ betont die Bedeutung der Erzählung in der medizinischen Wissensvermittlung. Die Metapher„Der Patient als Text“ ist vor dem Hintergrund der narrativen Theorie entwickelt worden. Literaturforscher haben lange die Bedeutung von Metaphern als sprachliche Wirkungsmittel untersucht. Dieser Artikel beschreibt die Bedeutung von Metaphern in der medizinischen Kommunikation und Wissensbildung und schlägt den Begriff„dialogbasierte Medizin“ als notwendige Ergänzung zum Begriff„evidenzbasierte Medizin“ vor“
Unter dieser Überschrift plädiert der Allgemeinmediziner Harald Kamps (Foto: www.praxis-kamps.de) in einem schönen Artikel für die Berücksichtigung einer„dialogbasierten Medizin“ als notwendige Ergänzung zur„evidenzbasierten Medizin“. Der Artikel ist 2004 in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin erschienen (Ausg. 80, S. 438-442) und online zu lesen. Im abstract heißt es:„Sprachliche Bilder, Metaphern, die in dem Gespräch zwischen Arzt und Patient vorkommen, können zu einem besseren Verständnis der Krankengeschichte und des Behandlungsverlaufes beitragen. Metaphern können auch ein sprachliches Mittel sein, um Themen zuberühren, die in einer konkreten Sprache schwierig zu vermitteln sind: Tod, Trauer und Schmerzen. Metaphern im Arztgespräch können aus der Lebenswelt des Patienten geholt werden, aber auch aus der Wissenswelt der Medizin. Die medizinische Sprache wird geprägt von Metaphern aus Krieg und Technik. Der angelsächsische Begriff„narrative based medicine“ betont die Bedeutung der Erzählung in der medizinischen Wissensvermittlung. Die Metapher„Der Patient als Text“ ist vor dem Hintergrund der narrativen Theorie entwickelt worden. Literaturforscher haben lange die Bedeutung von Metaphern als sprachliche Wirkungsmittel untersucht. Dieser Artikel beschreibt die Bedeutung von Metaphern in der medizinischen Kommunikation und Wissensbildung und schlägt den Begriff„dialogbasierte Medizin“ als notwendige Ergänzung zum Begriff„evidenzbasierte Medizin“ vor“

 2002 hat David Becker (Foto: Phil. Fak. der Uni Düsseldorf), einer der exponiertesten Experten im Umgang mit dem Thema politischer Traumatisierungen, ein Projekttutorium an der FU Berlin durchgeführt, seine Ausführungen sind zum größten Teil transkribiert worden. Im Internet ist ein guter Text zu lesen, in dem er seine Gedanken über die individuell-therapeutischen und politisch-gesellschaftlichen Konstruktionen traumatischer Belastungen darstellt: Ein Flüchtling ist nicht nur Flüchtling, weil ihn in seinem Heimatland soziale Verhältnisse dazu gemacht haben, sondern er ist auch bei uns Flüchtling, entsprechend der Art und Weise, wie wir dieses Thema hier konstruieren. Bei uns gibt es praktisch keine positiven sozialen Konstruktion von Flüchtlingen mehr. Es gibt nur neutrale bis negative Konstruktionen: sie bleiben zu lange hier, wir müssen die Zuwanderung regeln, wir müssen aufpassen. Wir hatten eine positive Wertung von Flüchtlingen, solange der Kalte Krieg noch an- dauerte. Jeder einzelne unserer guten Brüder und Schwestern, die aus dem Osten kamen, wurden hier politisch gefeiert. Im Kalten Krieg gab es, zumin- dest was die Ostblockstaaten betraf, eine positive Besetzung dieses Terminus. Inzwischen gibt es keine positive soziale Konstruktion diese Terminus mehr. Man sollte darüber nachdenken, wie man diesen Terminus wieder positiv besetzen kann, damit wir die Kraft haben, Leute aufzunehmen, denen es woanders schlecht geht.
2002 hat David Becker (Foto: Phil. Fak. der Uni Düsseldorf), einer der exponiertesten Experten im Umgang mit dem Thema politischer Traumatisierungen, ein Projekttutorium an der FU Berlin durchgeführt, seine Ausführungen sind zum größten Teil transkribiert worden. Im Internet ist ein guter Text zu lesen, in dem er seine Gedanken über die individuell-therapeutischen und politisch-gesellschaftlichen Konstruktionen traumatischer Belastungen darstellt: Ein Flüchtling ist nicht nur Flüchtling, weil ihn in seinem Heimatland soziale Verhältnisse dazu gemacht haben, sondern er ist auch bei uns Flüchtling, entsprechend der Art und Weise, wie wir dieses Thema hier konstruieren. Bei uns gibt es praktisch keine positiven sozialen Konstruktion von Flüchtlingen mehr. Es gibt nur neutrale bis negative Konstruktionen: sie bleiben zu lange hier, wir müssen die Zuwanderung regeln, wir müssen aufpassen. Wir hatten eine positive Wertung von Flüchtlingen, solange der Kalte Krieg noch an- dauerte. Jeder einzelne unserer guten Brüder und Schwestern, die aus dem Osten kamen, wurden hier politisch gefeiert. Im Kalten Krieg gab es, zumin- dest was die Ostblockstaaten betraf, eine positive Besetzung dieses Terminus. Inzwischen gibt es keine positive soziale Konstruktion diese Terminus mehr. Man sollte darüber nachdenken, wie man diesen Terminus wieder positiv besetzen kann, damit wir die Kraft haben, Leute aufzunehmen, denen es woanders schlecht geht.