30. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
30. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Alltags-Sound
Sampled Room from Mateusz Zdziebko on Vimeo.
29. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Kontrolle
28. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
UTB 40 Jahre
 Die Reihe UTB, enstanden aus einem Zusammenschluss von zunächst 11 und mittlerweile 17 Fachverlagen, feiert ihr 40. Jubiläum und hat aus diesem Anlass ein kostenloses e-book als PDF veröffentlicht, das einige Texte aus bisher über 1000 veröffentlichten Büchern enthält. Für Systemiker ist mit einem Ausschnitt aus Jochen Schweitzers und Arist von Schlippes Buch über„systemische Interventionen“ auch etwas dabei. Ansonsten findet sich im Inhaltsverzeichnis folgendes: 1. Karl Vocelka: Technik- und Wissenschaftsentwicklung der Neuzeit, 2. Arnold/Sandfuchs/ Wiechmann: Geschichte des Unterrichts, 3. Wolfgang Kunkel/Martin Schermaier: Römische Rechtsgeschichte: Das ius civile der Frühzeit, 4. Reinhard Wendt: Geschichte der Globalisierung (16001857), 5. Manuela Spindler/Siegfried Schieder: Interdependenz und internationale Beziehungen, 6. Elisabeth Göbel: Unterschiedliche Typen ethischer Argumentation, 7. Konrad Paul Liessmann: Ludwig Wittgenstein und Karl R. Popper, 8. Karl Popper: Wahrheit und Annäherung an die Wahrheit, 9. Jochen Vogt: Von Lust und Frust der Lektüre, 10. Michael Meyer: Literary Theory, 11. Pierre Bourdieu: Ein lebender Vorwurf, 12. Ursula Hasler-Roumois: Die intelligente Organisation, 13. Arist von Schlippe/Jochen Schweitzer: Interventionen in der systemischen Team- und Organisations-Beratung, 14. Hansjürg Geiger: Astrobiologie: Auf der Suche nach Leben im All, 15. Wolfgang Nentwig: Invasive Arten durch unbeabsichtigte Verschleppung, 16. Stahr/Kandeler/Herrmann/Streck: Die Böden, das dritte Umweltmedium, 17. Theo R. Payk Krankheitszeichen und Untersuchungen bei Demenz – eine wahrlich bunte Mischung.
Die Reihe UTB, enstanden aus einem Zusammenschluss von zunächst 11 und mittlerweile 17 Fachverlagen, feiert ihr 40. Jubiläum und hat aus diesem Anlass ein kostenloses e-book als PDF veröffentlicht, das einige Texte aus bisher über 1000 veröffentlichten Büchern enthält. Für Systemiker ist mit einem Ausschnitt aus Jochen Schweitzers und Arist von Schlippes Buch über„systemische Interventionen“ auch etwas dabei. Ansonsten findet sich im Inhaltsverzeichnis folgendes: 1. Karl Vocelka: Technik- und Wissenschaftsentwicklung der Neuzeit, 2. Arnold/Sandfuchs/ Wiechmann: Geschichte des Unterrichts, 3. Wolfgang Kunkel/Martin Schermaier: Römische Rechtsgeschichte: Das ius civile der Frühzeit, 4. Reinhard Wendt: Geschichte der Globalisierung (16001857), 5. Manuela Spindler/Siegfried Schieder: Interdependenz und internationale Beziehungen, 6. Elisabeth Göbel: Unterschiedliche Typen ethischer Argumentation, 7. Konrad Paul Liessmann: Ludwig Wittgenstein und Karl R. Popper, 8. Karl Popper: Wahrheit und Annäherung an die Wahrheit, 9. Jochen Vogt: Von Lust und Frust der Lektüre, 10. Michael Meyer: Literary Theory, 11. Pierre Bourdieu: Ein lebender Vorwurf, 12. Ursula Hasler-Roumois: Die intelligente Organisation, 13. Arist von Schlippe/Jochen Schweitzer: Interventionen in der systemischen Team- und Organisations-Beratung, 14. Hansjürg Geiger: Astrobiologie: Auf der Suche nach Leben im All, 15. Wolfgang Nentwig: Invasive Arten durch unbeabsichtigte Verschleppung, 16. Stahr/Kandeler/Herrmann/Streck: Die Böden, das dritte Umweltmedium, 17. Theo R. Payk Krankheitszeichen und Untersuchungen bei Demenz – eine wahrlich bunte Mischung.
Zum Download
27. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Sinnsuche im Wandel
 Im systemagazin erschien bereits im vergangenen Herbst ein Vorabdruck aus dem neuen Buch von Helm Stierlin im Carl-Auer-Verlag, in dem dieser eine sehr persönliche Bilanz seines Therapeutenlebens zieht. Für die„Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung“ hat Wolfgang Loth nun eine Rezension geschrieben, die mit freundlicher Genehmigung des Verlages modernes lernen auch im systemagazin zu lesen ist, und zieht ein überwiegend positives Resümé:„Ich habe das Buch von Anfang bis Ende neugierig gelesen, bin dem Autor dankbar für das Aufgreifen dieses Themas, fühle mich angeregt und wünsche dem Buch viele LeserInnen, die sich dadurch ermutigen lassen, im Getümmel unserer Profession den Bezug zu Sinn aufrechtzuerhalten und nicht irre zu werden angesichts der Verlockungen von Ideen, die aus unserer Profession einen Strichcode machen würden“
Im systemagazin erschien bereits im vergangenen Herbst ein Vorabdruck aus dem neuen Buch von Helm Stierlin im Carl-Auer-Verlag, in dem dieser eine sehr persönliche Bilanz seines Therapeutenlebens zieht. Für die„Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung“ hat Wolfgang Loth nun eine Rezension geschrieben, die mit freundlicher Genehmigung des Verlages modernes lernen auch im systemagazin zu lesen ist, und zieht ein überwiegend positives Resümé:„Ich habe das Buch von Anfang bis Ende neugierig gelesen, bin dem Autor dankbar für das Aufgreifen dieses Themas, fühle mich angeregt und wünsche dem Buch viele LeserInnen, die sich dadurch ermutigen lassen, im Getümmel unserer Profession den Bezug zu Sinn aufrechtzuerhalten und nicht irre zu werden angesichts der Verlockungen von Ideen, die aus unserer Profession einen Strichcode machen würden“
Zur vollständigen Rezension
26. Januar 2011
von Tom Levold
3 Kommentare
systemagazin wird 6!

26. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Systemische Organisationsberatung jenseits von Fach- und Prozessberatung
 Der systemische Organisationsberater Rudolf Wimmer plädiert in der aktuellen„revue für postheroisches management“ dafür, über die tradierte Arbeitsteilung von expertenorientierter Fach- und Prozessberatung hinauszudenken. Sein Aufsatz ist jetzt auch auf der website von osb-international nachzulesen:„Die Jahrzehnte lang stabile Aufteilung der Beratungsbranche in die expertenorientierte Fachberatung dominiert von den weltweit operierenden großen Beratungsunternehmen und in die auf gelingende Kommunikation spezialisierte Prozessberatung ist in Bewegung gekommen. Mehr als vier Jahrzehnte hindurch haben kontinuierliche Wachstumsraten das Selbstverständnis in diesen professionellen Lagern und ihre wechselseitige Abgrenzung, bisweilen auch Abwertung bestätigt. Die Anzeichen verstärken sich, dass diese stabile Branchensegmentierung und ihre bestimmenden Grenzen im Begriff sind, sich aufzuweichen. Als prominentes Beispiel dafür kann die intensive Diskussion um den Sinn und Zweck der Komplementärberatung dienen (Königswieser, Lang, Wimmer 2009). Die Bemühungen nehmen deutlich zu, diese beiden professionellen Welten in ihren jeweiligen Lösungsrepertoires miteinander zu verbinden (Handler 2007). Offensichtlich wächst bei immer mehr Kunden ein grundsätzliches Unbehagen an jenen eingeführten Beratungsdienstleistungen, die in ihrer bisherigen Ausprägung aus dem Selbstverständnis der tradierten Arbeitsteilung von expertenorientierter Fach- und Prozessberatung resultieren (Gömmel 2010)“
Der systemische Organisationsberater Rudolf Wimmer plädiert in der aktuellen„revue für postheroisches management“ dafür, über die tradierte Arbeitsteilung von expertenorientierter Fach- und Prozessberatung hinauszudenken. Sein Aufsatz ist jetzt auch auf der website von osb-international nachzulesen:„Die Jahrzehnte lang stabile Aufteilung der Beratungsbranche in die expertenorientierte Fachberatung dominiert von den weltweit operierenden großen Beratungsunternehmen und in die auf gelingende Kommunikation spezialisierte Prozessberatung ist in Bewegung gekommen. Mehr als vier Jahrzehnte hindurch haben kontinuierliche Wachstumsraten das Selbstverständnis in diesen professionellen Lagern und ihre wechselseitige Abgrenzung, bisweilen auch Abwertung bestätigt. Die Anzeichen verstärken sich, dass diese stabile Branchensegmentierung und ihre bestimmenden Grenzen im Begriff sind, sich aufzuweichen. Als prominentes Beispiel dafür kann die intensive Diskussion um den Sinn und Zweck der Komplementärberatung dienen (Königswieser, Lang, Wimmer 2009). Die Bemühungen nehmen deutlich zu, diese beiden professionellen Welten in ihren jeweiligen Lösungsrepertoires miteinander zu verbinden (Handler 2007). Offensichtlich wächst bei immer mehr Kunden ein grundsätzliches Unbehagen an jenen eingeführten Beratungsdienstleistungen, die in ihrer bisherigen Ausprägung aus dem Selbstverständnis der tradierten Arbeitsteilung von expertenorientierter Fach- und Prozessberatung resultieren (Gömmel 2010)“
Zum vollständigen Text
25. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Systeme in aggressiven Krisen was könnte helfen?
 Andreas Fryszer, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- u. Jugendtherapeut, Systemischer Berater (DGSF), Lehrender für Systemische Beratung (DGSF) und Teammitglied im Praxis-Institut (Regionalinstitut Süd; Foto: dortselbst) hat einen Vortrag zum Thema Umgang mit aggressiven Krisen im Bereich der Jugendhilfe gehalten, der auch online zu lesen ist:„In aggressiven Krisen selbst ist kein wirkungsvolles erzieherisches oder therapeutisches Handeln möglich. Aggression, Angst und Stress sind organisch Zustände in denen der Sympathikus sehr aktiviert ist: hohe Erregung, Anspannung, hoher Blutdruck, schneller Puls, Aktivierung von Wahrnehmung. Die Bildung von neuen Verschaltungen im Gehirn, die komplexe Handlungsmuster ermöglichen, ist unter hoher Erregung des Sympathikus unwahrscheinlich. Dazu ist ein mittleres Stressniveau nötig. Die Neurobiologie hat dies nachweisen können. Auf hohem Stressniveau oder auch Angstniveau sind lediglich drei vorprogrammierte Verhaltensweisen wahrscheinlich: Angreifen, Fliehen oder Erstarren. In solchen Situationen findet allerdings Lernen auf einer anderen Ebene statt. Einzelne Sinneseindrücke, Bilder, Worte, Stimmen werden intensiv gespeichert. Menschen, die traumatisierenden Situationen ausgesetzt sind, sind in großer Erregung. Sie nehmen solche einzelne Fakten tief auf und speichern diese leider sehr löschungsresistent. Die Erinnerungen an diese Bilder, Stimmen, Worte oder Farben lösen dann wieder die dazu- gehörigen Erregungszustände aus. Das wird Ihnen wohl bekannt sein, wenn Sie mit traumatisierten Jugendlichen und Kindern arbeiten. Wenn wir von Erziehung oder Therapie reden, geht es aber »um den Aufbau von kom- plexerem neuen Verhaltensmustern, um die Verknüpfung des Neuen mit bereits bekannten Inhalten und um die Anwendung des Gelernten auf viele Situationen und Beispiele.«“
Andreas Fryszer, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- u. Jugendtherapeut, Systemischer Berater (DGSF), Lehrender für Systemische Beratung (DGSF) und Teammitglied im Praxis-Institut (Regionalinstitut Süd; Foto: dortselbst) hat einen Vortrag zum Thema Umgang mit aggressiven Krisen im Bereich der Jugendhilfe gehalten, der auch online zu lesen ist:„In aggressiven Krisen selbst ist kein wirkungsvolles erzieherisches oder therapeutisches Handeln möglich. Aggression, Angst und Stress sind organisch Zustände in denen der Sympathikus sehr aktiviert ist: hohe Erregung, Anspannung, hoher Blutdruck, schneller Puls, Aktivierung von Wahrnehmung. Die Bildung von neuen Verschaltungen im Gehirn, die komplexe Handlungsmuster ermöglichen, ist unter hoher Erregung des Sympathikus unwahrscheinlich. Dazu ist ein mittleres Stressniveau nötig. Die Neurobiologie hat dies nachweisen können. Auf hohem Stressniveau oder auch Angstniveau sind lediglich drei vorprogrammierte Verhaltensweisen wahrscheinlich: Angreifen, Fliehen oder Erstarren. In solchen Situationen findet allerdings Lernen auf einer anderen Ebene statt. Einzelne Sinneseindrücke, Bilder, Worte, Stimmen werden intensiv gespeichert. Menschen, die traumatisierenden Situationen ausgesetzt sind, sind in großer Erregung. Sie nehmen solche einzelne Fakten tief auf und speichern diese leider sehr löschungsresistent. Die Erinnerungen an diese Bilder, Stimmen, Worte oder Farben lösen dann wieder die dazu- gehörigen Erregungszustände aus. Das wird Ihnen wohl bekannt sein, wenn Sie mit traumatisierten Jugendlichen und Kindern arbeiten. Wenn wir von Erziehung oder Therapie reden, geht es aber »um den Aufbau von kom- plexerem neuen Verhaltensmustern, um die Verknüpfung des Neuen mit bereits bekannten Inhalten und um die Anwendung des Gelernten auf viele Situationen und Beispiele.«“
Zum vollständigen Text
24. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Family Process geht ins 50ste Jahr!

Der Jahrgang 2011 wird der 50ste Jahrgang von„Family Process“ sein, die damit ihr erstes halbes Jahrhundert voll macht. Die Herausgeberin Evan Imber-Black schreibt im Editorial der letzten Ausgabe von 2010:„This is an opportunity for submission of major review articles examining the history and developmental arcs of Family Therapy theory, practice, and research, as well as out of the box manuscripts in keeping with the vision of our founders. (Well, some of our origins were out of the box and some were not, as exemplified by the line in the opening essay, The journal will welcome reports of experiences by therapists treating married couples and families [Italics added] [p. 4].) Theory and practice had not yet acknowledged single parent families, couples who lived together without marriage, or re-marriage. Gay and lesbian couples and gay and lesbian headed households were invisible. And while the founders asked for studies which categorize families by culture and by class (p. 4), it would be a long time before nuanced papers examining the complexities of culture and class emerged. The journal was born just as the paroxysms of the 1960s were beginning. Our shift from studying the individual and intra-psychic to the systemic and relational was but one change in a decade marked by the expansion of civil rights, social changes wrought by the war in Vietnam, and incipient movements for social justice, many still unrealized. I am hoping that authors will view this moment of the 50th year of Family Process to send their very best workwork that is lens-changing, paradigm-shifting, and surprising“ Das Jahr 2011 soll also auch eines des Rückblick auf Erreichtes und des Ausblicks auf Zukünftiges sein. Das vorliegende Heft hat einen deutlichen Forschungsschwerpunkt, unter den Arbeiten befindet sich auch eine Zusammenfassung der Wirksamkeitsstudie zur Systemischen Therapie von Kirsten von Sydow, Stefan Beher, Jochen Schweitzer und Rüdiger Retzlaff. Darüber hinaus finden sich auch noch zwei eher praxisbezogene Beiträge zur Paartherapie, die sich mit Eifersucht (Michele Scheinkman & Denise Werneck) und mit„Good Enough Stories“ (Karen Skerrett) beschäftigen.
Zu den vollständigen abstracts
23. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Ethan Watters: Crazy like us
22. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Lesetipp von Alexander Servus:
„Seit etwas über einem Jahr kann man bei www.differentia.wordpress.com das Blog von Klaus Kusanowsky verfolgen. Er schreibt regelmäßig ein Blog, das sich mit soziologischer Systemtheorie befasst Der Schwerpunkt liegt bislang auf Analysen und Reflexionen über die Entwicklung des Internets. Alle Artikel sind von einem Roten Faden durchzogen, der durch zwei Fragen gekennzeichnet ist: 1. Von welcher Art der Erfahrung ist eine Industriegesellschaft geprägt? 2. Was ändert sich, wenn die Gewohnheiten sich durch das Internet ändern müssen? Wer Interesse daran hat, das Blog regelmäßig zu verfolgen, muss aber etwas Geduld mitbringen. Nicht immer erschließt sich in jedem Artikel alles Gelesene sofort. Manchmal sind es wohl nur Fragmente, aber nach und nach zeichnet sich wie bei einem Puzzle ein zusammenhängendes Bild ab. Ob man allen Argumenten dabei auch folgen will, ist eine andere Sache, jedenfalls gibt es nicht viele Blogs, die so aufwändig geschrieben sind“
22. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Snuggling on the beach (thanks, Lynn!)
21. Januar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Neurobiologie der Psychotherapie reloaded
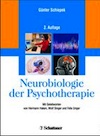 „Im Jahre 2003, nach neurowissenschaftlicher Zeitrechnung also vor Urzeiten, erschien die erste Auflage des vorliegenden Buches. Leider muss jedem Besitzer des Erstlingswerks zugemutet werden, sich die Neuauflage zu besorgen. Zuviel ist in diesem interdisziplinären Forschungsfeld zwischen Hirnforschung und Psychotherapie in der Zwischenzeit passiert. Diese Zweitauflage ist ein völlig neues Buch mit brandaktuellen Artikeln. Ich empfehle wärmstens, mit Schiepek neu durch zu starten und sich auf den aktuellen Stand zu bringen“, schreibt Rezensent Andreas Manteufel über das neue Buch des Herausgebers Günter Schiepek. In der Tat ein Mammutwerk mit 700 großformatigen Seiten, fast 2,5 Kilogramm schwer und mit 43 Beiträgen reichlich gefüllt. Wer sich mit der Relevanz der Hirnforschung und Neurobiologie für die Psychotherapie beschäftigt, unabhängig ob er mit dieser Ausrichtung sympathisiert oder nicht, kommt an diesem Band wohl kaum vorbei. Neben der Rezension von Andreas Manteufel finden Sie im systemagazin auch noch eine Besprechung von Matthias Ochs (systemisch-forschen.de).
„Im Jahre 2003, nach neurowissenschaftlicher Zeitrechnung also vor Urzeiten, erschien die erste Auflage des vorliegenden Buches. Leider muss jedem Besitzer des Erstlingswerks zugemutet werden, sich die Neuauflage zu besorgen. Zuviel ist in diesem interdisziplinären Forschungsfeld zwischen Hirnforschung und Psychotherapie in der Zwischenzeit passiert. Diese Zweitauflage ist ein völlig neues Buch mit brandaktuellen Artikeln. Ich empfehle wärmstens, mit Schiepek neu durch zu starten und sich auf den aktuellen Stand zu bringen“, schreibt Rezensent Andreas Manteufel über das neue Buch des Herausgebers Günter Schiepek. In der Tat ein Mammutwerk mit 700 großformatigen Seiten, fast 2,5 Kilogramm schwer und mit 43 Beiträgen reichlich gefüllt. Wer sich mit der Relevanz der Hirnforschung und Neurobiologie für die Psychotherapie beschäftigt, unabhängig ob er mit dieser Ausrichtung sympathisiert oder nicht, kommt an diesem Band wohl kaum vorbei. Neben der Rezension von Andreas Manteufel finden Sie im systemagazin auch noch eine Besprechung von Matthias Ochs (systemisch-forschen.de).
Zur vollständigen Rezension
