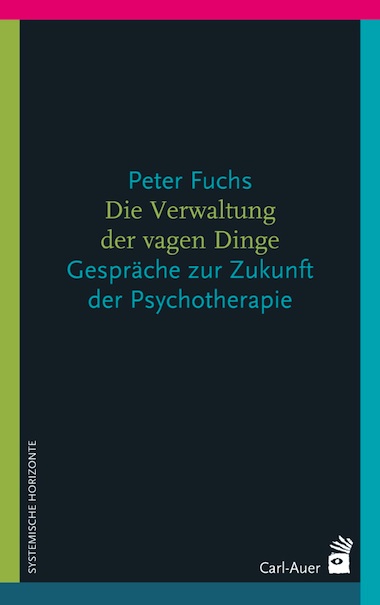20. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
18. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Guttenberg: Kompetenz-Team hat versagt
 Auf einer Pressekonferenz, die kurzfristig auf dem Bundeswehr-Stützpunkt in Kundus einberufen worden ist, hat Verteidigungsminister von und zu Guttenberg auf überzeugende Weise alle Vorwürfe ausräumen können, er habe eigenhändig in seiner Dissertation fremde Textpassagen als eigene ausgegeben und sich damit eines Plagiates schuldig gemacht. Er distanzierte sich scharf von Textmanipulationen aller Art.„Ich habe mit diesen bedauerlichen und dummen Vorgehensweisen nicht nur nicht das Geringste zu tun, sondern missbillige sie aufs Äußerste“, versicherte der Minister vor den Journalisten. Verletzungen der Regeln wissenschaftlichen Zitierens seien unentschuldbar. Dies habe er auch seinem fünfköpfigen Kompetenz-Team, das die Doktorarbeit für ihn verfasst habe, immer wieder nachdrücklich klargemacht. Auch wenn der Fall noch genauer untersucht werden müsse, sei für ihn nach einem Anruf der Bild-Zeitung jetzt schon klar, dass der Kapitän des Kompetenz-Teams versagt habe. Er habe ihn daraufhin mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt entlassen. Auf die Frage, warum er überhaupt die Dissertation von anderen habe schreiben lassen, antwortete Guttenberg, ihm habe natürlich an einer hohen Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeit gelegen, da habe es know how und qualifizierte Fachkräfte gebraucht:„Meine Reden und Vorträge vor dem Parlament und in der Öffentlichkeit schreibe ich ja auch nicht selbst, sondern dafür ausgebildete Fachkräfte. Das ist bei einer Doktorarbeit ja nicht anders. Da muss man auf die Mitarbeiter vertrauen können. Und wenn ich überhaupt jemanden zitiere, dann sind das die Fachkräfte – zum Rapport“
Auf einer Pressekonferenz, die kurzfristig auf dem Bundeswehr-Stützpunkt in Kundus einberufen worden ist, hat Verteidigungsminister von und zu Guttenberg auf überzeugende Weise alle Vorwürfe ausräumen können, er habe eigenhändig in seiner Dissertation fremde Textpassagen als eigene ausgegeben und sich damit eines Plagiates schuldig gemacht. Er distanzierte sich scharf von Textmanipulationen aller Art.„Ich habe mit diesen bedauerlichen und dummen Vorgehensweisen nicht nur nicht das Geringste zu tun, sondern missbillige sie aufs Äußerste“, versicherte der Minister vor den Journalisten. Verletzungen der Regeln wissenschaftlichen Zitierens seien unentschuldbar. Dies habe er auch seinem fünfköpfigen Kompetenz-Team, das die Doktorarbeit für ihn verfasst habe, immer wieder nachdrücklich klargemacht. Auch wenn der Fall noch genauer untersucht werden müsse, sei für ihn nach einem Anruf der Bild-Zeitung jetzt schon klar, dass der Kapitän des Kompetenz-Teams versagt habe. Er habe ihn daraufhin mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt entlassen. Auf die Frage, warum er überhaupt die Dissertation von anderen habe schreiben lassen, antwortete Guttenberg, ihm habe natürlich an einer hohen Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeit gelegen, da habe es know how und qualifizierte Fachkräfte gebraucht:„Meine Reden und Vorträge vor dem Parlament und in der Öffentlichkeit schreibe ich ja auch nicht selbst, sondern dafür ausgebildete Fachkräfte. Das ist bei einer Doktorarbeit ja nicht anders. Da muss man auf die Mitarbeiter vertrauen können. Und wenn ich überhaupt jemanden zitiere, dann sind das die Fachkräfte – zum Rapport“
17. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Soziale Konstruktion und pädagogische Praxis
 Auf der website von Kenneth Gergen findet sich das Manuskript eines Beitrages, der im von Rolf Balgo herausgegebenen Sammelband„Lernen und Lernprobleme im systemischen Diskurs“ erschienen ist (verlag modernes lernen, Dortmund 2003), in dem es um Erziehung aus sozialkonstruktionistischer Perspektive geht:„Erziehungspraktiken sind üblicherweise mit einem Netzwerk von Annahmen verbunden, das heisst, mit einem Satz von vorläufigen Überzeugungen hinsichtlich der Natur der Menschen, ihrer Fähigkeiten, und ihrer Beziehung zur Welt und zueinander. Im Fall von Erziehung ist der Begriff, um den sich alles dreht, vielleicht der des Wissens. Wie gelangen wir also zu einer Definition bzw. einer begrifflichen Erfassung des Wissens in einer Weise, die erzieherische Prozesse wünschenswert oder erforderlich erscheinen läßt; was ist spezifisch für Wissen, um bestimmten erzieherische Praktiken gegenüber anderen den Vorzug zu geben? Natürlich werden miteinander unvereinbare Begriffe von Wissen zu unterschiedlichen Ansichten über den Erziehungsprozess führen. Wenn wir – wie gewisse Romantiker der Meinung wären – ,„das Herz hat Verstand“, könnten wir Bücher und Vorlesungen durch intensive Begegnungen sowohl der individuellen wie auch der spirituellen Art ersetzen. Sollten wir uns der Auffassung von Ilongot von Nord-Luzon anschliessen, dass nämlich Wissen gewonnen wird, wenn man von Zorn überwältigt wird oder sich auf die Jagd nach Köpfen macht, dann könnte das formale Unterrichten in der Schule durch Erfahrungen in der Schlacht ersetzt werden. Überzeugungen über das Wissen beeinflussen, rechtfertigen und unterstützen also unsere Erziehungsmethoden.
Auf der website von Kenneth Gergen findet sich das Manuskript eines Beitrages, der im von Rolf Balgo herausgegebenen Sammelband„Lernen und Lernprobleme im systemischen Diskurs“ erschienen ist (verlag modernes lernen, Dortmund 2003), in dem es um Erziehung aus sozialkonstruktionistischer Perspektive geht:„Erziehungspraktiken sind üblicherweise mit einem Netzwerk von Annahmen verbunden, das heisst, mit einem Satz von vorläufigen Überzeugungen hinsichtlich der Natur der Menschen, ihrer Fähigkeiten, und ihrer Beziehung zur Welt und zueinander. Im Fall von Erziehung ist der Begriff, um den sich alles dreht, vielleicht der des Wissens. Wie gelangen wir also zu einer Definition bzw. einer begrifflichen Erfassung des Wissens in einer Weise, die erzieherische Prozesse wünschenswert oder erforderlich erscheinen läßt; was ist spezifisch für Wissen, um bestimmten erzieherische Praktiken gegenüber anderen den Vorzug zu geben? Natürlich werden miteinander unvereinbare Begriffe von Wissen zu unterschiedlichen Ansichten über den Erziehungsprozess führen. Wenn wir – wie gewisse Romantiker der Meinung wären – ,„das Herz hat Verstand“, könnten wir Bücher und Vorlesungen durch intensive Begegnungen sowohl der individuellen wie auch der spirituellen Art ersetzen. Sollten wir uns der Auffassung von Ilongot von Nord-Luzon anschliessen, dass nämlich Wissen gewonnen wird, wenn man von Zorn überwältigt wird oder sich auf die Jagd nach Köpfen macht, dann könnte das formale Unterrichten in der Schule durch Erfahrungen in der Schlacht ersetzt werden. Überzeugungen über das Wissen beeinflussen, rechtfertigen und unterstützen also unsere Erziehungsmethoden.
Ausgehend von dieser Bedeutung der grundlegenden Annahmen möchten wir zunächst zwei Kernbegriffe des Wissens skizzieren, die der westlichen Tradition lieb und teuer sind, Begriffe, die auch heute noch einen großen Teil der Erziehungspraktiken beeinflussen, an denen wir teilhaben. Wie wir im Anschluss daran behaupten werden, sind diese eng miteinander verwandten Glaubenssysteme zutiefst problematisch hinsichtlich der Epistemologie wie auch der Ideologie, der sie sich verpflichtet fühlen. Sodann werden wir eine Alternative zu diesen Sichtweisen umreißen, und zwar eine Alternative, die sich aus dem Standpunkt des sozialen Konstruktionismus ergibt. Der soziale Konstruktionismus versucht nicht, die traditionellen Sichtweisen zu zerstören, bietet aber eine bedeutende Alternative an. Hierbei eröffnet er zudem eine neue Möglichkeit, die bestehenden Erziehungspraktiken zu verstehen und auch Perspektiven für neue Gebiete von Möglichkeiten“
Zum vollständigen Text
16. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Berlusconi: Lösung des Flüchtlingsproblems
 Mit einem Eil-Gesetz hat der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi auf den Flüchtlingsnotstand in Italien reagiert. Am gestrigen Dienstag setzte er mit Hilfe seiner Parlamentsmehrheit den Veränderung der Volljährigkeitsgrenze für ausländische Mädchen von bisher 18 Jahren auf nunmehr 14 Jahre durch. Das Gesetz, demzufolge Kinder ab 14 Jahren legal der Prostitution nachgehen dürfen, gilt rückwirkend ab dem 1.1.2000 und erfasst auch den Fall der bislang als Minderjährige eingestuften Prostituierten„Ruby“ aus Marokko. Berlusconi wurde zur Last gelegt, sie und andere Minderjährige für Sex bezahlt zu haben. Er zeigte sich auf einer Pressekonferenz mit dem neuen Gesetz zufrieden:„Wir haben einen guten Beitrag zur Integration der Mädchen aus Nordafrika geleistet, die nun einer sinnvollen Arbeit legal nachgehen, ihre Familien ordentlich ernähren und den Staat von Sozialaufgaben entlasten können. Außerdem wird es der italienischen Justiz endlich nicht mehr möglich sein, mich und andere italienische Männer vor Gericht zu bringen, nur weil wir etwas tun, was richtige Männer tun“.
Mit einem Eil-Gesetz hat der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi auf den Flüchtlingsnotstand in Italien reagiert. Am gestrigen Dienstag setzte er mit Hilfe seiner Parlamentsmehrheit den Veränderung der Volljährigkeitsgrenze für ausländische Mädchen von bisher 18 Jahren auf nunmehr 14 Jahre durch. Das Gesetz, demzufolge Kinder ab 14 Jahren legal der Prostitution nachgehen dürfen, gilt rückwirkend ab dem 1.1.2000 und erfasst auch den Fall der bislang als Minderjährige eingestuften Prostituierten„Ruby“ aus Marokko. Berlusconi wurde zur Last gelegt, sie und andere Minderjährige für Sex bezahlt zu haben. Er zeigte sich auf einer Pressekonferenz mit dem neuen Gesetz zufrieden:„Wir haben einen guten Beitrag zur Integration der Mädchen aus Nordafrika geleistet, die nun einer sinnvollen Arbeit legal nachgehen, ihre Familien ordentlich ernähren und den Staat von Sozialaufgaben entlasten können. Außerdem wird es der italienischen Justiz endlich nicht mehr möglich sein, mich und andere italienische Männer vor Gericht zu bringen, nur weil wir etwas tun, was richtige Männer tun“.
15. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Embracing change in clinical practice
Unter dieser Überschrift versammelt die aktuelle Ausgabe des„Journal of Family Therapy“ eine Reihe von Aufsätzen, die ganz der empirischen Therapieforschung gewidmet sind. Unter anderem geht es um „family-focused intervention for children and families affected by maternal depression“,„Multidimensional treatment foster care“,„Therapeutic alliance and progress in couple therapy“,„Predictors of treatment attendance among adolescent substance abusing runaways“ und„effects of meeting a family therapy supervision team on client satisfaction in an initial session“.
Zu den vollständigen abstracts
14. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
ZUR BEDEUTUNG VON RITUALEN IN TIEFGREIFENDEN VERÄNDERUNGSPROZESSEN VON UNTERNEHMUNGEN
 Niemals sind Organisationen so intensiven Veränderungsprozessen ausgesetzt gewesen wie in der heutigen Zeit. Eine beträchtliche Rolle bei der Frage, wie die Mitglieder den Wandel in Organisationen meistern können, spielen die Frage, welche Rolle Rituale zur Ausbalancierung von Veränderung und Stabilität sowie zur Bewältigung von Ungewissheit spielen (können). Johannes Rüegg-Stürm (Foto: Universität St. Gallen) und Lukas Gritsch vom Institut für Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen sind dieser Frage 2001 in einem Diskussionspapier nachgegangen, das die Handhabung von Ungewissheit als eine zentrale Herausforderung des Management von Wandel versteht. Symbole und Rituale haben für sie die Funktion, den an Veränderungsprozessen Beteiligten emotional und kognitiv erfahrbar zu machen,„was im Vollzug des Alltags und des Lebens insgesamt über alle Bruchstellen hinweg von entscheidender Bedeutung ist bzw. immer wieder neu von Bedeutung sein soll“. Dennoch lässt sich nicht daraus folgern, dass im Change Management der Einsatz von Ritualen eine Management-Strategie sein könnte:„Einem Management von Ritualen wird dabei eine klare Absage erteilt, einerseits aus ethischen Überlegungen und andererseits im klaren Bewusstsein für die Grenzen der Machbarkeit beim Management sozialer Prozesse. Es wäre geradezu blanker Zynismus und die Spitze eines sozialtechnokratischen Managementverständnisses (vgl. hierzu Ulrich 1984), wenn auf diese Weise vorgetäuscht würde, auch die weichen Faktoren liessen sich beliebig in den Griff zu bekommen. Nicht eine weitere Steigerung von Herrschaftswissen von Menschen über Menschen ist das Kernanliegen dieses Beitrags, sondern eine Sensibilisierung für Rituale und deren Bedeutung und Wirkung in tiefgreifenden Veränderungsprozessen von Unternehmungen“
Niemals sind Organisationen so intensiven Veränderungsprozessen ausgesetzt gewesen wie in der heutigen Zeit. Eine beträchtliche Rolle bei der Frage, wie die Mitglieder den Wandel in Organisationen meistern können, spielen die Frage, welche Rolle Rituale zur Ausbalancierung von Veränderung und Stabilität sowie zur Bewältigung von Ungewissheit spielen (können). Johannes Rüegg-Stürm (Foto: Universität St. Gallen) und Lukas Gritsch vom Institut für Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen sind dieser Frage 2001 in einem Diskussionspapier nachgegangen, das die Handhabung von Ungewissheit als eine zentrale Herausforderung des Management von Wandel versteht. Symbole und Rituale haben für sie die Funktion, den an Veränderungsprozessen Beteiligten emotional und kognitiv erfahrbar zu machen,„was im Vollzug des Alltags und des Lebens insgesamt über alle Bruchstellen hinweg von entscheidender Bedeutung ist bzw. immer wieder neu von Bedeutung sein soll“. Dennoch lässt sich nicht daraus folgern, dass im Change Management der Einsatz von Ritualen eine Management-Strategie sein könnte:„Einem Management von Ritualen wird dabei eine klare Absage erteilt, einerseits aus ethischen Überlegungen und andererseits im klaren Bewusstsein für die Grenzen der Machbarkeit beim Management sozialer Prozesse. Es wäre geradezu blanker Zynismus und die Spitze eines sozialtechnokratischen Managementverständnisses (vgl. hierzu Ulrich 1984), wenn auf diese Weise vorgetäuscht würde, auch die weichen Faktoren liessen sich beliebig in den Griff zu bekommen. Nicht eine weitere Steigerung von Herrschaftswissen von Menschen über Menschen ist das Kernanliegen dieses Beitrags, sondern eine Sensibilisierung für Rituale und deren Bedeutung und Wirkung in tiefgreifenden Veränderungsprozessen von Unternehmungen“
Zum vollständigen Text
13. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Erkenne Dich selbst!
12. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Vorabdruck > Peter Fuchs: Die Verwaltung der vagen Dinge
Peter Fuchs gehört zu denjenigen unter den Systemtheoretikern und Luhmann-Schülern, die sich am hartnäckigsten mit der Frage nach der Psyche und psychischen Systemen auseinandersetzen. Im Carl-Auer-Verlag erscheint in diesem Frühjahr sein neues Buch, das sich mit der Systemtheorie der Psychotherapie beschäftigt. Wie Fritz Simon in seinem Vorwort schreibt, ist es kein Buch im eigentlichen Sinne, sondern das Transkript eines Gesprächskreises:„Was hier dokumentiert wird, ist ein Privatissimum. Darunter versteht man in der akademischen Welt eine Lehrveranstaltung in einem entspannten und informellen Kreis weniger, handverlesener Teilnehmer. Und insofern wird (zumindest ansatzweise) reinszeniert, was auch in der Psychotherapie geschieht: Die Verwaltung vager Dinge (zu denen Psychotherapie ja zweifellos gehört)“ Mit dieser Art der Darstellungsart wird nicht jeder glücklich sein, da die dokumentierten Gespräche doch gelegentlich etwas stark die Aura einer Meister-Schüler-Unterweisung zelebrieren, für manche mag es den Zugang zu theoretisch abstrakten Konzepten erleichtern. Was sich jedoch auf jeden Fall festhalten lässt: In diesem Band werden eine Vielzahl eindrucksvoller, origineller, mitunter heilsam verstörender Thesen und Einsichten zur systemtheoretischen Bestimmung von Psychotherapie entwickelt, an denen wir als systemische TherapeutInnen nicht vorbei können. Zu wünschen wäre, dass dies die erlahmte Diskussionskultur im systemischen Feld gerade in Zeiten der Orientierung am„wissenschaftlichen Mainstream“ beflügeln könnte. Eine entscheidende These von Fuchs ist hier die Abgrenzung der Psychotherapie von der Medizin, die in erster Linie mit codierten bzw. codierbaren Problemen zu tun habe (was sich dann in Klassifikationen wie etwa dem ICD niederschlägt. Dagegen ist„die Funktion der Psychotherapie (
)situiert im Kontext einer funktional differenzierten Gesellschaft, die jede Einheitsprätention, jedes Bestehen auf eineindeutigen Identitätsbestimmungen prekär macht. Im Blick auf psychische Systeme fallen dabei (Leidensdruck erzeugende) Unschärfeprobleme an, auf die sich dann die Psychotherapie bezieht, indem sie nichtcodierte und nichtcodierbare Probleme nicht codifiziert, sondern gelten lässt durch Strategien, die zu viablen Identitätskonzepten führen, innerhalb deren es möglich wird, mit Unschärfen zu leben“ Eine solche Sichtweise hat nachhaltige Auswirkungen auf Fragen der Problemkonstruktion, der Diagnostik und des therapeutischen Prozesses, die im weiteren Verlauf des Buches behandelt werden. Als Vorabdruck präsentiert systemagazin das Kapitel über
„Die Funktion der Psychotherapie“
11. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
[AUTOSAVED] Lera Boroditsky: How Language Shapes Thought
In Fora-TV
11. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Doppelkarrieren. Familien- und Berufsorganisation von Dual Career Couples
 Im Jahre 2001 haben Ute und Ulrich Clement einen Beitrag für die„Familiendynamik“ über Beziehungen von„Doppelkarriere-Partnern“ verfasst, dessen Manuskript auch auf der website von Ulrich Clement heruntergeladen werden kann:„Beziehungen von Doppelkarriere-Partnern haben aufgrund ihrer symmetrischen Struktur spezifische Herausforderungen zu bewältigen. Im Gegensatz zu komplementär organisierten traditionellen Beziehungen stehen ihnen keine kulturell präformierten Regulationsmuster zur Verfügung. Es werden Konflikte an der Außen/Innen-Schnittstelle zwischen Beruf und Familie, und an der Innen/Innen-Schnittstelle des Ausgleichs zwischen den Partnern untersucht. Ansätze von Lösungsperspektiven setzen an der Gestaltung der Ressourcenorganisation und des inneren Aushandlungsprozesses solcher Beziehungen an. Als Schlüsselkompetenz wird dabei der Umgang mit der kritischen Ressource Zeit gesehen“
Im Jahre 2001 haben Ute und Ulrich Clement einen Beitrag für die„Familiendynamik“ über Beziehungen von„Doppelkarriere-Partnern“ verfasst, dessen Manuskript auch auf der website von Ulrich Clement heruntergeladen werden kann:„Beziehungen von Doppelkarriere-Partnern haben aufgrund ihrer symmetrischen Struktur spezifische Herausforderungen zu bewältigen. Im Gegensatz zu komplementär organisierten traditionellen Beziehungen stehen ihnen keine kulturell präformierten Regulationsmuster zur Verfügung. Es werden Konflikte an der Außen/Innen-Schnittstelle zwischen Beruf und Familie, und an der Innen/Innen-Schnittstelle des Ausgleichs zwischen den Partnern untersucht. Ansätze von Lösungsperspektiven setzen an der Gestaltung der Ressourcenorganisation und des inneren Aushandlungsprozesses solcher Beziehungen an. Als Schlüsselkompetenz wird dabei der Umgang mit der kritischen Ressource Zeit gesehen“
Zum vollständigen Text
9. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Seit wann erleben wir die Welt als gestaltbar?
In der Mediathek des Bayrischen Rundfunks findet sich ein Video des Systemtheoretikers Armin Nassehi, in dem dieser kurzweilig über die Macht der Gesellschaft als„Gesellschaft mit beschränkter Haftung“:„Wir leben in einer Gesellschaft, in einer koordinierten Welt. Normalerweise machen wir uns darüber keine Gedanken. Doch allein die Tatsache, dass wir mit der U-Bahn fahren können oder Kaffeekochen, ist erstaunlich“ (Link-Tipp von Dirk Kowalis).
Zum Video
9. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
Umfrage: Wie beeinflussen soziodemographische Merkmale von Beratern den Beratungsprozess?
Dieser Fragestellung widmet sich eine Befragung, aus der eine Dissertation hervorgehen soll und die im Rahmen des vom BMBF geförderten Forschungsprojektes Innovative Konzepte der Personal- und Organisationsentwicklung in Beratungsunternehmen (IPOB) unter Leitung von Prof. Dr. Michael Mohe an der Universität Oldenburg erstellt wird. Hierfür wird Ihre Unterstützung erbeten. Wie können Sie helfen? Sie können helfen, indem Sie 10 Minuten für die Forschung investieren und diesen Online-Fragebogen bis zum 25.02.2011 ausfüllen. Für Ihre Teilnahme an der Studie erhalten Sie eine zusammenfassende Auswertung der Ergebnisse. Alle Ihre Angaben werden anonymisiert und streng vertraulich behandelt! Für Rückfragen steht Ihnen der Doktorand Dipl.-Soz. Daniel Dorniok zur Verfügung.
8. Februar 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
16. Herbstakademie in Jena 2010
 „Vom 11. – 13. 10. 2010 fand zum 16ten Mal die sogenannte Herbstakademie in einer kleinen aber feinen Runde von rund 40 Teilnehmern statt. Die Herbstakademie kann als interdisziplinäres Forum von Wissenschaftlern verstanden werden, die ihre Arbeit in den Kontext der synergetischen Systemtheorie stellen. Sie findet seit 1990 in ein- oder zweijährigem Abstand statt und ist von Prof. Günter Schiepek, Prof. Wolfgang Tschacher und Prof. Ewald Johannes Brunner begründet worden. 2010 fand die Tagung, wie auch schon einige Male zuvor, in Jena statt, diesmal in den schönen Rosensälen der Friedrich Schiller-Universität Jena direkt am altehrwürdigen Fürstengraben. Sie wurde veranstaltet von Prof. Ewald Johannes Brunner, Prof. Karsten Kenklies und Prof. Wolfgang Tschacher in Kooperation mit dem Forschungszentrum„Laboratorium Aufklärung“ (www.fzla.uni-jena.de) und dem Frege-Centre for Structural Sciences (www.frege.uni-jena.de). Das Thema war diesmal Selbstorganisation von Wissenschaft – ausgehend von der Annahme, dass sowohl die Einzelwissenschaften als auch der Wissenschaftsbetrieb als solcher auf Selbstorganisationsprozessen beruhen und dementsprechend Eigendynamiken entwickeln“ So beginnt ein ausführlicher und sehr informativer Tagungsbericht von Matthias Ochs, den dieser auf der von ihm betreuten website systemisch-forschen.de veröffentlicht hat.
„Vom 11. – 13. 10. 2010 fand zum 16ten Mal die sogenannte Herbstakademie in einer kleinen aber feinen Runde von rund 40 Teilnehmern statt. Die Herbstakademie kann als interdisziplinäres Forum von Wissenschaftlern verstanden werden, die ihre Arbeit in den Kontext der synergetischen Systemtheorie stellen. Sie findet seit 1990 in ein- oder zweijährigem Abstand statt und ist von Prof. Günter Schiepek, Prof. Wolfgang Tschacher und Prof. Ewald Johannes Brunner begründet worden. 2010 fand die Tagung, wie auch schon einige Male zuvor, in Jena statt, diesmal in den schönen Rosensälen der Friedrich Schiller-Universität Jena direkt am altehrwürdigen Fürstengraben. Sie wurde veranstaltet von Prof. Ewald Johannes Brunner, Prof. Karsten Kenklies und Prof. Wolfgang Tschacher in Kooperation mit dem Forschungszentrum„Laboratorium Aufklärung“ (www.fzla.uni-jena.de) und dem Frege-Centre for Structural Sciences (www.frege.uni-jena.de). Das Thema war diesmal Selbstorganisation von Wissenschaft – ausgehend von der Annahme, dass sowohl die Einzelwissenschaften als auch der Wissenschaftsbetrieb als solcher auf Selbstorganisationsprozessen beruhen und dementsprechend Eigendynamiken entwickeln“ So beginnt ein ausführlicher und sehr informativer Tagungsbericht von Matthias Ochs, den dieser auf der von ihm betreuten website systemisch-forschen.de veröffentlicht hat.
Zum vollständigen Text