5. Juni 2011
von Tom Levold
Keine Kommentare
 Seit 9 Jahren leben Katja und Robert zusammen. Sie haben eine Tochter von 8 und einen Sohn von 7 Jahren. Katja, Lehrerin, ist halbtags berufstätig, und Robert arbeitet als Bautechniker. Beide lieben ihre Kinder und ihre Arbeit. Aber ihre Beziehung sei seit der Geburt der Kinder lustlos und monoton, es gebe kaum noch leidenschaftliche Begegnungen. Robert fragt, ob sie vielleicht dafür eine Sexualtherapie bräuchten?
Seit 9 Jahren leben Katja und Robert zusammen. Sie haben eine Tochter von 8 und einen Sohn von 7 Jahren. Katja, Lehrerin, ist halbtags berufstätig, und Robert arbeitet als Bautechniker. Beide lieben ihre Kinder und ihre Arbeit. Aber ihre Beziehung sei seit der Geburt der Kinder lustlos und monoton, es gebe kaum noch leidenschaftliche Begegnungen. Robert fragt, ob sie vielleicht dafür eine Sexualtherapie bräuchten?
Weil das Thema Sex zu jeder guten Paarberatung gehört, ermutige ich das Paar zur Fortsetzung der Gespräche bei mir. Katja erzählt zerknirscht, dass sie sich in einen jungen Kollegen (der davon nichts weiss) verliebt und es inzwischen Robert gestanden habe, worauf dieser mit der Bemerkung, dass er das bei so viel Kälte zwischen ihnen normal finde, zur Tagesordnung übergegangen sei. Roberts Vernunft und Gelassenheit in allen Lebenslagen löst bei Katja immer wieder Verzweiflung aus und gibt ihr das Gefühl, Teil des häuslichen Inventars zu sein. Zwar schlafen sie noch ab und zu miteinander, aber ohne Feuer. Robert: «Ich möchte schon, dass es sexuell wieder so lebendig wird zwischen uns, wie es vor der Geburt der Kinder war, und dass Katja so experimentierfreudig ist wie damals aber wie soll das gelingen, wenn sie andere Männer in ihre Phantasien lässt?» Katja: «Ich frage mich mit schlechtem Gewissen, warum das so ist. Eigentlich liebe ich Robert. Kürzlich habe ich meine sexuellen Wünsche aufgeschrieben. Aber es kam mir nur Banales in den Sinn. Meine grösste Sehnsucht ist, dass Robert mir wieder einmal in die Augen schaut, wenn er mich begehrt, damit ich weiss, er meint mich und nicht einfach seine eigene Entspannung.»
Es sind selten Tragödien, mit denen Paare zu mir kommen, sondern ganz gewöhnliche, alltägliche Enttäuschungen wie eben, dass Lust und Leidenschaft nach der Geburt von Kindern in der Familie «verschwimmen». Es scheint eine normale Unvereinbarkeit zwischen Bindung und Sexualität und zwischen Elternschaft und sinnlicher Paarbeziehung zu geben. Der Graben kann aber überbrückt werden, wenn beide bereit sind, einander ihre Wünsche zuzumuten. Denn die Glut ihrer sexuellen Sehnsüchte lebt im Geheimen fast immer weiter, und der Sauerstoff, welcher sie anfacht, entsteht auf vielfältige Weise: zum Beispiel in der ausserehelichen Verliebtheit, dem Romeo- und-Julia-Syndrom des Unmöglichen. Wenn ein solches Erlebnis als Vorbote von Wandel statt als Tragödie verstanden wird und das Paar eigene Liebesinseln findet, können sexuelle Begegnungen «mit offenen Augen» zur Wiederbelebung der Leidenschaft führen.
Im Jahre 2002 hat die im vergangenen Jahr verstorbene systemische Paartherapeutin Rosmarie Welter-Enderlin allwöchentlich Sonntags in der Neuen Zürcher Zeitung eine Kolummne mit dem schönen Titel„Paarlauf“ veröffentlicht, in der sie kleine Beobachtungen und Geschichten aus ihrer paartherapeutischen Praxis für ein größeres Publikum zugänglich machte. Rudolf Welter hat aus diesen Beiträgen eine kleine Broschüre zum Andenken an Rosmarie Welter-Enderlin gestaltet. Mit seiner freundlichen Erlaubnis können die LeserInnen des systemagazin an diesen Sonntagen die Texte auch online lesen.
 Lilo Schmitz, Sozialpädagogin, Kulturanthropologin und Professorin für Methoden der Sozialen Arbeit, lehrt seit 15 Jahren Lösungsorientierte Gesprächsführung und Beratung an der Fachhochschule Düsseldorf und in der Fort- und Weiterbildung. 2009 hat sie ein Buch mit„Übungen und Bausteinen für Hochschule, Ausbildung & kollegiale Lerngruppen“ verfasst, das im verlag modernes lernen in Dortmund erschienen ist. Peter Olm und Cornelia Tsirigotis haben es besprochen. Ihre Rezensionen
Lilo Schmitz, Sozialpädagogin, Kulturanthropologin und Professorin für Methoden der Sozialen Arbeit, lehrt seit 15 Jahren Lösungsorientierte Gesprächsführung und Beratung an der Fachhochschule Düsseldorf und in der Fort- und Weiterbildung. 2009 hat sie ein Buch mit„Übungen und Bausteinen für Hochschule, Ausbildung & kollegiale Lerngruppen“ verfasst, das im verlag modernes lernen in Dortmund erschienen ist. Peter Olm und Cornelia Tsirigotis haben es besprochen. Ihre Rezensionen
 In einem spannenden„Essay zur Kritikabilität sozialer Systeme“ setzt sich der Soziologe und Systemtheoretiker Peter Fuchs mit den Möglichkeiten einer Gesellschaftskritik auseinander, die offensichtlich eines Adressaten mangelt, da die Gesellschaft eben keine repräsentierbare Adresse vorweist.„Ein Schlüsselproblem bei der Rezeption und der Anwendung des Systembegriffs der Systemtheorie ist die ständig mitlaufende Metaphorik des Raumes. Psychische und soziale Systeme werden als Räume oder Quasi-Räume imaginiert. Sie verfügen dann über Grenzen, die ihren Innenraum vom Außenraum (der Umwelt) trennen und sich überschreiten lassen in einer Art Grenzverkehr. Solche Systeme werden vorgestellt als Be-Inhalter, als Behältnisse von systemeigenen Einheiten, Strukturen und Prozessen, die nicht in ihrem Außen vorkommen. Übersehen wird dabei, daß das Sinnsystem definiert ist als Differenz von System und Umwelt. Als Differenz, das heißt: Es ist nicht deren linke Seite, es ist so wenig lokalisiert wie die rechte Seite, die Umwelt, von der ohne System kaum die Rede sein könnte. Nicht anders verhält es sich mit dem System: Es ist, was es ist, durch die Differenz zur Umwelt. Seine Einheit ist diese Differenz. Kurz: Sinnsysteme sind nicht wie die Dinge, die wir sonst kennen. Sie sind transklassische Objekte oder in behelfsmäßiger Formulierung Unjekte. Wenn man von dieser Abstraktionslage ausgeht, ändern sich die Bedingungen, unter denen man über Gesellschaftskritik nachdenken kann“. Unter diesen Voraussetzungen könne Gesellschaftskritik allenfalls als Organisationskritik gedacht werden.
In einem spannenden„Essay zur Kritikabilität sozialer Systeme“ setzt sich der Soziologe und Systemtheoretiker Peter Fuchs mit den Möglichkeiten einer Gesellschaftskritik auseinander, die offensichtlich eines Adressaten mangelt, da die Gesellschaft eben keine repräsentierbare Adresse vorweist.„Ein Schlüsselproblem bei der Rezeption und der Anwendung des Systembegriffs der Systemtheorie ist die ständig mitlaufende Metaphorik des Raumes. Psychische und soziale Systeme werden als Räume oder Quasi-Räume imaginiert. Sie verfügen dann über Grenzen, die ihren Innenraum vom Außenraum (der Umwelt) trennen und sich überschreiten lassen in einer Art Grenzverkehr. Solche Systeme werden vorgestellt als Be-Inhalter, als Behältnisse von systemeigenen Einheiten, Strukturen und Prozessen, die nicht in ihrem Außen vorkommen. Übersehen wird dabei, daß das Sinnsystem definiert ist als Differenz von System und Umwelt. Als Differenz, das heißt: Es ist nicht deren linke Seite, es ist so wenig lokalisiert wie die rechte Seite, die Umwelt, von der ohne System kaum die Rede sein könnte. Nicht anders verhält es sich mit dem System: Es ist, was es ist, durch die Differenz zur Umwelt. Seine Einheit ist diese Differenz. Kurz: Sinnsysteme sind nicht wie die Dinge, die wir sonst kennen. Sie sind transklassische Objekte oder in behelfsmäßiger Formulierung Unjekte. Wenn man von dieser Abstraktionslage ausgeht, ändern sich die Bedingungen, unter denen man über Gesellschaftskritik nachdenken kann“. Unter diesen Voraussetzungen könne Gesellschaftskritik allenfalls als Organisationskritik gedacht werden.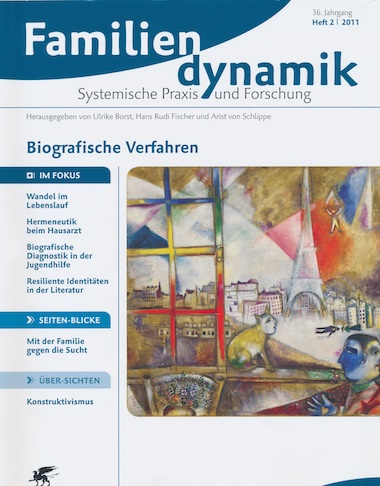
 Etwas vom Schönsten, was ich in Therapien erlebe, ist die reale Begegnung von erwachsenen Kindern mit ihren Eltern. Auf den ersten Blick ist es zwar einfacher, wenn beide Generationen über die Bilder klagen, die sie sich voneinander machen. «Schrecklich, diese Mutter. Sie hat mir nie gegeben, was ich gebraucht hätte.» Oder: «Unser Sohn hat die falsche Frau erwischt. Wenn die wüsste, wie wir Schwiegereltern unter ihr leiden.» Generationenprobleme können auch zu lösen versucht werden mit sogenannten Familienaufstellungen, bei denen fremde Rollenspieler vor möglichst viel Publikum die persönliche Sicht eines Mannes oder einer Frau von ihrer Herkunftsfamilie inszenieren. Lösungen für den «Aufsteller» werden dann von dem Gruppenleiter vorgegeben, indem er die richtige Ordnung zwischen den Generationen, zwischen Frauen und Männern und der Rangfolge der Geschwister herstellt und den Spielern mitteilt, wer wem Anerkennung oder Sühne zu leisten hat. Die entsprechenden Sprachregeln erinnern an katholisch- kirchliche Rituale. Es geht um Verneigungen vor denen, die einem das Leben schwer gemacht haben, oder um Würdigung jener, die keinen «guten Platz» hatten in der Familie. Diese Inszenierung einer individuellen Sichtweise schliesst die real Betroffenen (Vater, Mutter oder Geschwister) aus.
Etwas vom Schönsten, was ich in Therapien erlebe, ist die reale Begegnung von erwachsenen Kindern mit ihren Eltern. Auf den ersten Blick ist es zwar einfacher, wenn beide Generationen über die Bilder klagen, die sie sich voneinander machen. «Schrecklich, diese Mutter. Sie hat mir nie gegeben, was ich gebraucht hätte.» Oder: «Unser Sohn hat die falsche Frau erwischt. Wenn die wüsste, wie wir Schwiegereltern unter ihr leiden.» Generationenprobleme können auch zu lösen versucht werden mit sogenannten Familienaufstellungen, bei denen fremde Rollenspieler vor möglichst viel Publikum die persönliche Sicht eines Mannes oder einer Frau von ihrer Herkunftsfamilie inszenieren. Lösungen für den «Aufsteller» werden dann von dem Gruppenleiter vorgegeben, indem er die richtige Ordnung zwischen den Generationen, zwischen Frauen und Männern und der Rangfolge der Geschwister herstellt und den Spielern mitteilt, wer wem Anerkennung oder Sühne zu leisten hat. Die entsprechenden Sprachregeln erinnern an katholisch- kirchliche Rituale. Es geht um Verneigungen vor denen, die einem das Leben schwer gemacht haben, oder um Würdigung jener, die keinen «guten Platz» hatten in der Familie. Diese Inszenierung einer individuellen Sichtweise schliesst die real Betroffenen (Vater, Mutter oder Geschwister) aus.
 In der aktuellen Ausgabe der New York Review of Books ist der sehr lesenswerte erste Teil einer Besprechung dreier Psychopharmaka-kritischer Bücher von Marcia Angell erschienen. Darin heißt es:„Nowadays treatment by medical doctors nearly always means psychoactive drugs, that is, drugs that affect the mental state. In fact, most psychiatrists treat only with drugs, and refer patients to psychologists or social workers if they believe psychotherapy is also warranted. The shift from talk therapy to drugs as the dominant mode of treatment coincides with the emergence over the past four decades of the theory that mental illness is caused primarily by chemical imbalances in the brain that can be corrected by specific drugs. That theory became broadly accepted, by the media and the public as well as by the medical profession, after Prozac came to market in 1987 and was intensively promoted as a corrective for a deficiency of serotonin in the brain. The number of people treated for depression tripled in the following ten years, and about 10 percent of Americans over age six now take antidepressants. The increased use of drugs to treat psychosis is even more dramatic. The new generation of antipsychotics, such as Risperdal, Zyprexa, and Seroquel, has replaced cholesterol-lowering agents as the top-selling class of drugs in the US. What is going on here? Is the prevalence of mental illness really that high and still climbing? Particularly if these disorders are biologically determined and not a result of environmental influences, is it plausible to suppose that such an increase is real? Or are we learning to recognize and diagnose mental disorders that were always there? On the other hand, are we simply expanding the criteria for mental illness so that nearly everyone has one? And what about the drugs that are now the mainstay of treatment? Do they work? If they do, shouldnt we expect the prevalence of mental illness to be declining, not rising?“
In der aktuellen Ausgabe der New York Review of Books ist der sehr lesenswerte erste Teil einer Besprechung dreier Psychopharmaka-kritischer Bücher von Marcia Angell erschienen. Darin heißt es:„Nowadays treatment by medical doctors nearly always means psychoactive drugs, that is, drugs that affect the mental state. In fact, most psychiatrists treat only with drugs, and refer patients to psychologists or social workers if they believe psychotherapy is also warranted. The shift from talk therapy to drugs as the dominant mode of treatment coincides with the emergence over the past four decades of the theory that mental illness is caused primarily by chemical imbalances in the brain that can be corrected by specific drugs. That theory became broadly accepted, by the media and the public as well as by the medical profession, after Prozac came to market in 1987 and was intensively promoted as a corrective for a deficiency of serotonin in the brain. The number of people treated for depression tripled in the following ten years, and about 10 percent of Americans over age six now take antidepressants. The increased use of drugs to treat psychosis is even more dramatic. The new generation of antipsychotics, such as Risperdal, Zyprexa, and Seroquel, has replaced cholesterol-lowering agents as the top-selling class of drugs in the US. What is going on here? Is the prevalence of mental illness really that high and still climbing? Particularly if these disorders are biologically determined and not a result of environmental influences, is it plausible to suppose that such an increase is real? Or are we learning to recognize and diagnose mental disorders that were always there? On the other hand, are we simply expanding the criteria for mental illness so that nearly everyone has one? And what about the drugs that are now the mainstay of treatment? Do they work? If they do, shouldnt we expect the prevalence of mental illness to be declining, not rising?“