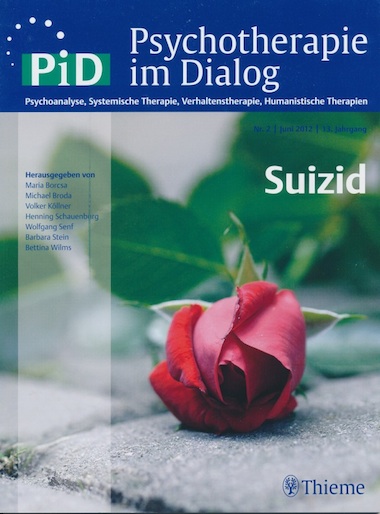15. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
14. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Pemas Tale: Intercultural Communication as Storytelling
In der ersten Ausgabe der Zeitschrift„Narrative Works. Issues, Investigations & Interventions“, die seit Frühjahr 2011 als Online-Journal allen Lesern Open Access zur Verfügung steht, plädiert Ellen Rose von der University of New Brunswik in ihrem Beitrag dafür, Interkulturelle Kommunikation nicht auf das Verständnis kultureller Differenzen zu reduzieren, sondern vielmehr die Ko-Konstruktion von Geschichten als Basis zu betrachten. Dabei stützt sie sich auf die Arbeiten Jerome Bruners über die Bedeutung von Narrativen für die Generierung von Bedeutung innerhalb einer Kultur, die sie auf die Kommunikation von Menschen unterschiedlicher Kulturen ausdehnt:„Intercultural communication is typically conceptualized in terms of business-oriented models that focus on the binary differences between cultural groups. Beginning with Edward Hall, the foundational premise is that the basis of effective communication with people of cultures other than our own is a thorough understanding of the disparities between cultural groups. This paper argues that intercultural communication should entail not merely the business-like, efficient exchange of information with different others but the crucial development of a feeling of connection and an appreciation for diverse ways of being in the world. Building upon the work of Jerome Bruner, it further suggests that the focus on dissimilarities which traditional models enforce obscures a true understanding of how intercultural communications can be enabled by a fundamental similarity: the human impulse to make sense of the world through narrative“
Zum vollständigen Text
13. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Animated Optical Illusions
12. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Suizidalität
Zwar steht schon die neue Ausgabe der„Psychotherapie im Dialog“ zum Thema Kurzzeittherapie ins Haus, doch soll hier noch die letzte Ausgabe vorgestellt werden, die vcn Bettina Wittmund und Maria Borcsa zum Thema Suizid herausgegeben worden ist. Die Beiträge umfassen diagnostische, medizinische, juristische und psychotherapeutische Aspekte des Umgangs mit Suizidhandlungen und -absichten. In ihrem Editorial machen die Herausgeberinnen deutlich, dass die Betrachtung von Suizidialität immer in einem Spannungsfeld zwischen anthropologischer Möglichkeit und pathologischer Einordnung stattfindet:„Zu Recht gilt es somit die Verzweiflung näher zu betrachten, denn einen Suizid durch eine dahinter liegende Suizidalität oder ausschließlich mit einer Psychopathologie zu erklären verkürzt die Vielfalt des Phänomens (
). Von einem Wunsch nach Ruhe, der sich bis zu einer Suizidhandlung entwickeln kann (
) existieren viele Abstufungen. Für PsychotherapeutInnen heißt das, dass verschiedene mögliche Ebenen der professionellen Intervention bereitstehen, die auch genutzt werden wollen“
Zu den vollständigen abstracts
11. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
A Safe Place for Change. Skills and Capacities for Counselling and Therapy
 Hugh Crago dürfte hierzulande nicht allzu bekannt sein, in Australien ist er einer der wichtigen Promotoren des systemischen Ansatzes, gemeinsam mit seiner Frau Maureen, mit der er über lange Zeit das Australian and New Zealand Journal of Family Therapy herausgegeben hat. In diesem Jahr ist ein Buch erschienen, das er mit Penny Gardner verfasst hat, die an der Universität Western Sydney wie auch Crago Lecturer in Counsellung ist, und das sich in erster Linie an Anfänger richtet. Im Vorwort heißt es:„This book is intended for students of counselling and therapy in their first year of training. We have attempted to describe capacities and skills that are fundamental to a range of widely used therapeutic approaches, from generalist counselling to specific models as different as psychoanalytic psychotherapy and cognitive behaviour therapy. Particular models require particular techniques, and we have not attempted a comprehensive coverage of model-specific skills. Instead, we have highlighted the skills that every competent helper needs when dealing with people in emotional distress: the competencies that make a practitioner effective no matter what model she or he professes“ Wolfgang Loth hat das Buch gelesen und resümiert:„Ich finde dieses Buch ebenso kompetent wie warmherzig geschrieben. Es ist kein Lehrbuch über Systemische oder Familientherapie, jedoch ein schönes Beispiel dafür, wie angehende KollegInnen dazu angeregt werden können, KlientInnen respektvoll zu begegnen und sich ihnen mit Zutrauen und Selbstvertrauen zur Verfügung zu stellen. Griffige Zusammenfassungen an den Kapitelenden, Lektüreempfehlungen und ein detailliertes Register runden den guten Eindruck ab“
Hugh Crago dürfte hierzulande nicht allzu bekannt sein, in Australien ist er einer der wichtigen Promotoren des systemischen Ansatzes, gemeinsam mit seiner Frau Maureen, mit der er über lange Zeit das Australian and New Zealand Journal of Family Therapy herausgegeben hat. In diesem Jahr ist ein Buch erschienen, das er mit Penny Gardner verfasst hat, die an der Universität Western Sydney wie auch Crago Lecturer in Counsellung ist, und das sich in erster Linie an Anfänger richtet. Im Vorwort heißt es:„This book is intended for students of counselling and therapy in their first year of training. We have attempted to describe capacities and skills that are fundamental to a range of widely used therapeutic approaches, from generalist counselling to specific models as different as psychoanalytic psychotherapy and cognitive behaviour therapy. Particular models require particular techniques, and we have not attempted a comprehensive coverage of model-specific skills. Instead, we have highlighted the skills that every competent helper needs when dealing with people in emotional distress: the competencies that make a practitioner effective no matter what model she or he professes“ Wolfgang Loth hat das Buch gelesen und resümiert:„Ich finde dieses Buch ebenso kompetent wie warmherzig geschrieben. Es ist kein Lehrbuch über Systemische oder Familientherapie, jedoch ein schönes Beispiel dafür, wie angehende KollegInnen dazu angeregt werden können, KlientInnen respektvoll zu begegnen und sich ihnen mit Zutrauen und Selbstvertrauen zur Verfügung zu stellen. Griffige Zusammenfassungen an den Kapitelenden, Lektüreempfehlungen und ein detailliertes Register runden den guten Eindruck ab“
Zur vollständigen Rezension
10. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
systhema 2/2012

Eine bunte Mischung aus Texten mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten und einer Menge Rezensionen von Wolfgang Loth, Andreas Manteufel, Hans-Georg Pflüger und Cornelia Tsirigotis füllen das aktuelle Heft der systhema. Zu den vollständigen abstracts
geht es hier
8. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Die Theorie der Systemtheorie erkenntnistheoretisch
 Im Internet ist ein Text von Peter Fuch über die erkenntnistheoretischen Implikationen der Systemtheorie zu lesen, der ursprünglich im Band„Theorie als Lehrgedicht – Systemtheoretische Essays I“ (hrsg. von Marie-Christin Fuchs) im Bielefelder transcript-Verlag 2004 erschienen ist:„Wenn es um die Frage der Bedingung der Möglichkeit von (soziologischer) Erkenntnis geht und wenn diese Frage gerichtet wird an die Systemtheorie der Bielefelder Provenienz, dann erhält man ein Antwortpaket, in das verschiedene Motive und Aspekte der Theorie hineinverschlungen sind, die untereinander keine hierarchischen (deduktiven oder induktiven) Beziehungen unterhalten, sondern eher heterarchisch verknotet sind und eine Gemengelage darstellen, in der Führungswechsel leitender Motive vorgesehen sind und in der sich von jedem gerade führenden Motiv aus Re-Arrangements des Erkenntnisproblems ergeben. Deswegen ist jeder (durch Textualität erzwungene) Bau von Sequenzen, in denen bestimmte Theoriemotive auf bestimmte folgen und anderen vorangehen, eigentümlich künstlich. In einer Metapher, die keinen Anspruch auf große Tragweite erhebt, könnte man vielleicht sagen, daß diese Theorie holographisch oder hologrammatisch abgebildet werden müßte, aber vorab nicht so abgebildet werden kann. Alle folgenden Überlegungen sollten unter dieser Kautele gelesen werden“
Im Internet ist ein Text von Peter Fuch über die erkenntnistheoretischen Implikationen der Systemtheorie zu lesen, der ursprünglich im Band„Theorie als Lehrgedicht – Systemtheoretische Essays I“ (hrsg. von Marie-Christin Fuchs) im Bielefelder transcript-Verlag 2004 erschienen ist:„Wenn es um die Frage der Bedingung der Möglichkeit von (soziologischer) Erkenntnis geht und wenn diese Frage gerichtet wird an die Systemtheorie der Bielefelder Provenienz, dann erhält man ein Antwortpaket, in das verschiedene Motive und Aspekte der Theorie hineinverschlungen sind, die untereinander keine hierarchischen (deduktiven oder induktiven) Beziehungen unterhalten, sondern eher heterarchisch verknotet sind und eine Gemengelage darstellen, in der Führungswechsel leitender Motive vorgesehen sind und in der sich von jedem gerade führenden Motiv aus Re-Arrangements des Erkenntnisproblems ergeben. Deswegen ist jeder (durch Textualität erzwungene) Bau von Sequenzen, in denen bestimmte Theoriemotive auf bestimmte folgen und anderen vorangehen, eigentümlich künstlich. In einer Metapher, die keinen Anspruch auf große Tragweite erhebt, könnte man vielleicht sagen, daß diese Theorie holographisch oder hologrammatisch abgebildet werden müßte, aber vorab nicht so abgebildet werden kann. Alle folgenden Überlegungen sollten unter dieser Kautele gelesen werden“
Zum vollständigen Text
6. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Balotelli
 Lange haben wir keine Post mehr aus Perturbistan bekommen, doch nun gibt es wieder einen neuen Beitrag von Lothar Eder zu lesen, der dieses Mal vor allem politically incorrect daherkommt und daher sicherlich perturbierende Wirkung entfalten wird. Mit politisch korrekten Statements ist daher zu rechnen.
Lange haben wir keine Post mehr aus Perturbistan bekommen, doch nun gibt es wieder einen neuen Beitrag von Lothar Eder zu lesen, der dieses Mal vor allem politically incorrect daherkommt und daher sicherlich perturbierende Wirkung entfalten wird. Mit politisch korrekten Statements ist daher zu rechnen.
„Wir nannten es als Kinder Mohrenkopf, in anderen Gegenden Deutschlands, so erfuhr ich später, wird es Negerkuss genannt; gemeint ist dieses Etwas aus Zuckerschaum, von Schokolade ummantelt, das im Kramerladen oder beim Bäcker 10 oder 20 Pfennige gekostet hat. Es war süß, himmlisch und ein Paradies auf der Zunge. Nun, der Mohr bzw. sein Kopf haben in Zeiten der politischen Korrektheit ihre Arbeit (jawohl, seine Arbeit, nicht etwa seine Schuldigkeit hat er getan, der Mohr, wie wir schiller- oder wenigstens stadelmaierbewanderten Klugmeier wissen!) längst getan und deshalb heißt die Sache mittlerweile Schaumspeise mit Migrationshintergrund
“
Weiterlesen kann man hier
5. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Der ethische Status des Kindes in der Familien- und Kinderpsychotherapie
1993 veröffentlichten Ludwig Reiter, Stella Reiter-Theil und Holger Eich zu diesem Thema einen Text in der„Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie“. Im abstrakt heißt es:„Die Implikationen der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Psycho- und Familientherapie werden aufgezeigt. Bezugnehmend auf den medizinethischen Diskurs zur Patientenaufklärung und informierten Zustimmung schlagen die Autoren vor, Minderjährige – ihren Kompetenzen entsprechend – verstärkt in Entscheidungen über die Teilnahme an Therapie und Behandlungsziele einzubeziehen. Mängel herkömmlicher Vorgehensweisen werden analysiert und im Lichte ethischer Prinzipien diskutiert. Empirische Daten zur angemessenen Beurteilung der Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen werden ausgewertet und Möglichkeiten für die praktische therapeutische und beraterische Arbeit empfohlen“. Der Artikel ist hier im Volltext zu lesen.Darüberhinaus baten die AutorInnen um kritische Kommentare von publizistisch tätigen TherapeutInnen aus dem Gebiet der Familientherapie/systematischen Therapie. Im Folgejahr gab es einen zweiten Text, der die Kritik dieser KollegInnen wiedergab und mit Überlegungen der AutorInnen zur weiteren Entwicklung der ethischen Diskussion in der Psychotherapie abschloss. Auch dieser Text ist online verfügbar,
und zwar hier
4. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Dirk Baecker über Überforderung durch Kommunikation
3. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Declaration of the American Society for Cybernetics
 „Cybernetics is a way of thinking, not a collection of facts. Thinking involves concepts: forming them and relating them to each other. Some of the concepts that characterize cybernetics have been about for a long time, implicitly or explicitly. Self-regulation and control, autonomy and communication, for example, are certainly not new in ordinary language, but they did not figure as central terms in any science“ So beginnt die„Declaration of the American Society for Cybernetics„, verfasst von Ernst von Glasersfeld, unter Mitwirkung von Stuart Umpleby, Paul Trachtman, Ranulph Glanville, Francisco Varela, Joseph Goguen, Bill Reckmeyer, Heinz von Foerster, Valentin Turchin, und Glasersfelds Frau Charlotte. Es ist ein Manifest der Kybernetik, nur fünf Seiten lang, aber eindringlich und ausdrucksstark. Es schließt mit einem optimistischen Statement hinsichtlich des gesellschaftlichen Potentials der Kybernetik 2. Ordnung, das man angesichts der derzeitigen weltpolitischen Situation allerdings nur mit einer gewissen Wehmut zur Kenntnis nimmt:„The wheel, the harnessing of electricity, the invention of antiseptics and the printing press have all had somewhat similar effects on the mechanics of living. Cybernetics has a far more fundamental potential. Its concepts of self-regulation, autonomy, and interactive adaptation provide, for the first time in the history of Western civilization, a rigorous theoretical basis for the achievement of dynamic equilibrium between human individuals, groups, and societies. Looking at the world today, it would be difficult not to conclude that a way of thinking which, rather than foster competition and conflict, deliberately aims at adaptation and collaboration may be the only way to maintain human life on this planet“
„Cybernetics is a way of thinking, not a collection of facts. Thinking involves concepts: forming them and relating them to each other. Some of the concepts that characterize cybernetics have been about for a long time, implicitly or explicitly. Self-regulation and control, autonomy and communication, for example, are certainly not new in ordinary language, but they did not figure as central terms in any science“ So beginnt die„Declaration of the American Society for Cybernetics„, verfasst von Ernst von Glasersfeld, unter Mitwirkung von Stuart Umpleby, Paul Trachtman, Ranulph Glanville, Francisco Varela, Joseph Goguen, Bill Reckmeyer, Heinz von Foerster, Valentin Turchin, und Glasersfelds Frau Charlotte. Es ist ein Manifest der Kybernetik, nur fünf Seiten lang, aber eindringlich und ausdrucksstark. Es schließt mit einem optimistischen Statement hinsichtlich des gesellschaftlichen Potentials der Kybernetik 2. Ordnung, das man angesichts der derzeitigen weltpolitischen Situation allerdings nur mit einer gewissen Wehmut zur Kenntnis nimmt:„The wheel, the harnessing of electricity, the invention of antiseptics and the printing press have all had somewhat similar effects on the mechanics of living. Cybernetics has a far more fundamental potential. Its concepts of self-regulation, autonomy, and interactive adaptation provide, for the first time in the history of Western civilization, a rigorous theoretical basis for the achievement of dynamic equilibrium between human individuals, groups, and societies. Looking at the world today, it would be difficult not to conclude that a way of thinking which, rather than foster competition and conflict, deliberately aims at adaptation and collaboration may be the only way to maintain human life on this planet“
Zum vollständigen Text
2. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Numerous Factors that matter beyond treatment strategies in Family Therapy

Unter dieses Motto, das einem Satz aus dem Editorial des Herausgebers Jay L. Lebow entnommen ist, könnte man die Beiträge der aktuellen Ausgabe der Family Process von Juni 2012 stellen. Die einzelnen Beiträge sind in Rubriken zusammengefasst:„Therapist and Educator Experiences“,„Systemic Considerations in the Treatment of Multi-Stressed Families“,„Families and Culture“ und„Family Therapy For Families With Members With Significant Difficulties In Functioning“. Aus dem letzteren Bereich ist auch ein Artikel online zu lesen, nämlich von„Understanding Autism: How Family Therapists Can Support Parents of Children with Autism Spectrum Disorders“ von Alexandra H. Solomon & Beth Chun.
Zu den vollständigen abstracts
1. September 2012
von Tom Levold
Keine Kommentare
Familienklasse
 Die erfolgreiche multifamilientherapeutische Arbeit, die Eia Asen und seine Gruppe in England entwickelt haben, findet auch in anderen Ländern, z.B. Dänemark und Deutschland, viel Resonanz. Beachtlich sind insbesondere die Erfolge, die im Rahmen eines multifamilientherapeutischen Ansatzes (family education) mit Kindern und Jugendlichen erzielt werden, die Schulprobleme haben. Das Konzept sieht hier nämlich vor, anstatt der Schüler alleine die ganze Familie in den Blick zu nehmen und mit der Schule zusammenzubringen. Die Arbeit mit den Familiengruppen wird auf den Schulalltag übertragen. Angeregt durch diese Modelle entwickelte die Tagesklinik Baumhaus des Schleiklinikums Schleswig gemeinsam mit der Schule Hesterberg in Schleswig das FiSch-Programm (Familie in Schule) zur Reintegration von Schülern mit sozialemotionalen Auffälligkeiten. Das FiSch-Team, Ulrike Behme-Matthiessen, Kerstin Bock, Andree Nykamp und Thomas Pletsch, haben ihre Erfahrungen nun zu einem„Handbuch Familienklasse“ zusammengestellt, das Jürgen Hargens für systemagazin gelesen hat, der resümiert:„Das Buch ist klar in der Sprache, benennt die bedeutsamen (Struktur-) Faktoren, gibt praktische Empfehlungen und macht Mut gerade durch die Praxisberichte aus anderen Gegenden. Es sollte für alle pädagogisch Tätigen zu einer Pflichtlektüre werden, auch (oder insbesondere) deshalb, weil es zeigt, dass etwas möglich ist zu tun (und zu ändern). Oder in leichter Abwandlung der Idee des Buches, Kinder in ihrem Lernen/Entwickeln zu unterstützen es kann Fachleute helfen, dazu zu lernen und das eigene Handeln zu ändern“
Die erfolgreiche multifamilientherapeutische Arbeit, die Eia Asen und seine Gruppe in England entwickelt haben, findet auch in anderen Ländern, z.B. Dänemark und Deutschland, viel Resonanz. Beachtlich sind insbesondere die Erfolge, die im Rahmen eines multifamilientherapeutischen Ansatzes (family education) mit Kindern und Jugendlichen erzielt werden, die Schulprobleme haben. Das Konzept sieht hier nämlich vor, anstatt der Schüler alleine die ganze Familie in den Blick zu nehmen und mit der Schule zusammenzubringen. Die Arbeit mit den Familiengruppen wird auf den Schulalltag übertragen. Angeregt durch diese Modelle entwickelte die Tagesklinik Baumhaus des Schleiklinikums Schleswig gemeinsam mit der Schule Hesterberg in Schleswig das FiSch-Programm (Familie in Schule) zur Reintegration von Schülern mit sozialemotionalen Auffälligkeiten. Das FiSch-Team, Ulrike Behme-Matthiessen, Kerstin Bock, Andree Nykamp und Thomas Pletsch, haben ihre Erfahrungen nun zu einem„Handbuch Familienklasse“ zusammengestellt, das Jürgen Hargens für systemagazin gelesen hat, der resümiert:„Das Buch ist klar in der Sprache, benennt die bedeutsamen (Struktur-) Faktoren, gibt praktische Empfehlungen und macht Mut gerade durch die Praxisberichte aus anderen Gegenden. Es sollte für alle pädagogisch Tätigen zu einer Pflichtlektüre werden, auch (oder insbesondere) deshalb, weil es zeigt, dass etwas möglich ist zu tun (und zu ändern). Oder in leichter Abwandlung der Idee des Buches, Kinder in ihrem Lernen/Entwickeln zu unterstützen es kann Fachleute helfen, dazu zu lernen und das eigene Handeln zu ändern“
Zur vollständigen Rezension