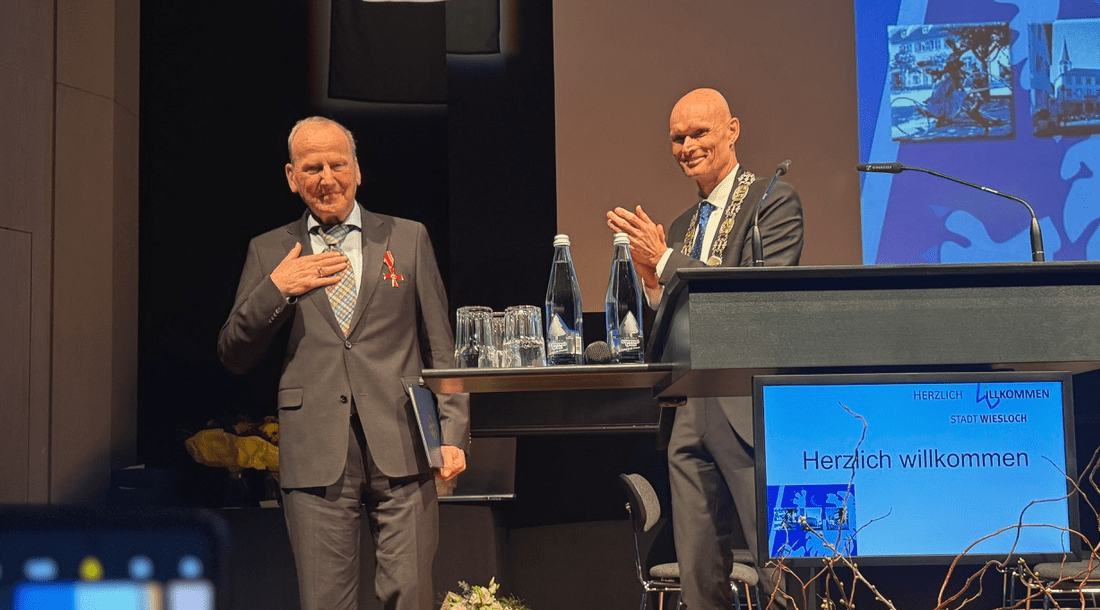- 121 000 junge Menschen lebten in Heimen und 86 000 in Pflegefamilien
- In jedem zweiten Fall waren die Eltern alleinerziehend
- 65 % der Betroffenen oder ihrer Herkunftsfamilien bezogen Transferleistungen
- Hauptgründe für neue Unterbringungen im Jahr 2022 waren der Ausfall von Bezugspersonen und Kindeswohlgefährdungen
WIESBADEN – Im Jahr 2022 wurden in Deutschland rund 121 000 junge Menschen in einem Heim und weitere rund 86 000 in einer Pflegefamilie betreut. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wuchsen damit rund 207 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene – zumindest zeitweise – außerhalb der eigenen Familie auf. Das waren 1 % oder rund 2 900 weniger junge Menschen als im Jahr zuvor.
Die Betroffenen: In gut jedem vierten Fall jünger als 10 Jahre
In gut jedem vierten Fall (27 %) waren die jungen Menschen, die 2022 außerhalb der eigenen Familie betreut wurden, jünger als 10 Jahre, in knapp jedem zweiten Fall (48 %) jünger als 14 Jahre. Minderjährig waren insgesamt vier Fünftel aller Betroffenen (80 %). Ein weiteres Fünftel (20 %) zählte zur Gruppe der sogenannten „Careleaver“, also zu den jungen Volljährigen an der Schwelle in ein eigenständiges Leben.
Während die jüngeren Kinder bis 9 Jahre häufiger in Pflegefamilien betreut wurden, überwog ab dem 10. Lebensjahr die Erziehung in einem Heim. Insgesamt wurden etwas mehr Jungen (54 %) als Mädchen (46 %) außerhalb der eigenen Familie erzogen. Im Schnitt endete die Unterbringung in einer Pflegefamilie nach über vier Jahren (50 Monate), eine Heimerziehung dagegen nach weniger als zwei Jahren (21 Monate).
Die Herkunftsfamilien: In jedem zweiten Fall alleinerziehend
Die Eltern der betroffenen jungen Menschen waren besonders häufig – nämlich in jedem zweiten Fall (50 %) – alleinerziehend. Bei jeweils knapp einem weiteren Fünftel der Herkunftsfamilien handelte es sich um Elternteile in neuer Partnerschaft (18 %) oder um zusammenlebende Elternpaare (18 %). In den verbleibenden Fällen war die Familiensituation unbekannt oder die Eltern verstorben.
Mit Blick auf die wirtschaftliche Situation bewegten sich die jungen Menschen beziehungsweise ihre Eltern oftmals nahe am Existenzminimum: In 65 % aller Fälle lebten die Betroffenen oder ihre Herkunftsfamilien vollständig oder teilweise von Transferleistungen. Dazu zählten Arbeitslosengeld II (SGB II), Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) sowie ein Kinderzuschlag. Besonders hoch war auch hier der Anteil bei Alleinerziehenden-Familien: Hier lag der Transferleistungsbezug mit 75 % deutlich über den vergleichbaren Anteilen von Elternteilen in neuer Partnerschaft (64 %) oder zusammenlebenden Elternpaaren (59 %).
Gründe für Neu-Unterbringungen: Ausfall der Bezugsperson und Kindeswohlgefährdung
58 400 junge Menschen waren 2022 neu in einem Heim oder einer Pflegefamilie untergebracht worden. Hauptgrund war mit 25 % der Ausfall der Bezugsperson der betroffenen jungen Menschen (Unversorgtheit), etwa durch eine Erkrankung oder durch eine unbegleitete Einreise aus dem Ausland. An zweiter Stelle stand 2022 die Gefährdung des Kindeswohls durch Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, psychische Misshandlung oder sexuelle Gewalt (17 %). Dritthäufigster Grund für eine neue Unterbringung war die eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern (13 %), beispielsweise durch pädagogische Überforderung oder Erziehungsunsicherheit.
Methodische Hinweise:
Die Betreuung in einem Heim nach § 34 SGB VIII oder einer Pflegefamilie nach § 33 SGB VIII sind Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, auf die Eltern minderjähriger Kinder unter bestimmten Voraussetzungen einen gesetzlichen Anspruch haben (§ 27 SGB VIII). In bestimmten Fällen räumt das Kinder- und Jugendhilferecht auch jungen Volljährigen bis zum 27. Lebensjahr einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen ein (§ 41 SGB VIII). Die Pressemitteilung weist alle Leistungen nach §§ 33, 34, 41 SGB VIII nach, die am Jahresende bestanden oder im Verlauf des Jahres beendet wurden.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse der Statistik der Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen bei (drohender) seelischer Behinderung (§§ 27 bis 35, 35a, 41 SGB VIII) können der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 22517) sowie der Themenseite „Hilfe zur Erziehung und Angebote der Jugendarbeit“ entnommen werden. (Quelle: destatis.de)