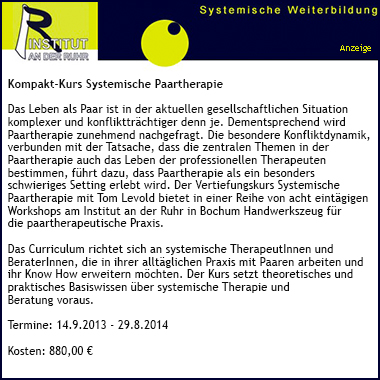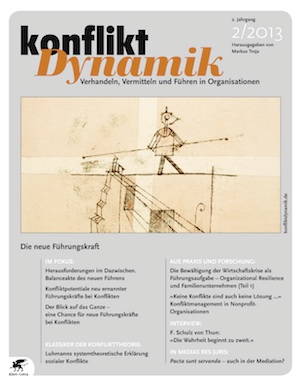17. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
16. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
Liebespaare und der Einfluss der Herkunftsfamilien – DGSF-Forschungspreis für Markus Schaer
 Ein Gastbeitrag von Sabine Jacobs, freie Autorin und Coach:
Ein Gastbeitrag von Sabine Jacobs, freie Autorin und Coach:
Ob und wie partnerschaftsrelevante Verhaltensweisen von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden, untersuchte der Psychologe Dr. Markus Schaer (Foto: Academia.edu) für seine Dissertation Das Früher im Heute: Liebespaare und ihre Herkunftsfamilien. Für seine Forschungsarbeit an der Universität München wurde Schaer mit dem Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) 2012 ausgezeichnet.
Schaers Arbeit beschreibt die intergenerationale Transmission von Paarkonfliktstilen und Kompetenzen zur Stressbewältigung. Der Autor interviewte junge erwachsene Paare und deren Eltern. Insgesamt nahmen mehr als 650 Personen an seiner Studie teil. Durch die Befragung ganzer Familiensysteme und mit systemischen Analyseverfahren konnte er ein differenziertes Bild der Transmission erarbeiten, das auch geschlechtstypische Unterschiede aufzeigt. Die Ergebnisse von Schaers Forschungsarbeit machen nachvollziehbar, wie familiäre Verhaltenstraditionen mit der sozialen Vererbung des Scheidungsrisikos zusammenhängen. Seine Analyse mehrgenerationaler Dynamiken und Muster von negativem und konstruktivem Konfliktverhalten liefert Erkenntnisse für die präventive und therapeutische Arbeit mit Paaren  und Familien. Die Untersuchung von Markus Schaer ist im Oktober 2012 im Asanger Verlag erschienen.
und Familien. Die Untersuchung von Markus Schaer ist im Oktober 2012 im Asanger Verlag erschienen.
Das Interview mit dem Autor Dr. Markus Schaer führte Sabine Jacobs:
Sabine Jacobs:
Du bist genau wie deine Mutter, dieser Satz fällt oft, wenn Paare streiten. Was ist dran – machen wir später tatsächlich nach, was wir im Elternhaus gelernt haben?
Markus Schaer:
Theoretisch könnte man ja von zwei Möglichkeiten ausgehen. Wir kopieren das Streitverhalten unserer Eltern oder aber wir verhalten uns bewusst anders, insbesondere dann, wenn in unserer Herkunftsfamilie eine destruktive Streitkultur an der Tagesordnung war. In der Forschung finden wir aber eher Kontinuitätszusammenhänge, das heißt, wir neigen dazu, es genauso zu machen, wie unsere Eltern. Das lässt sich für viele Verhaltensweisen zeigen, zum Beispiel für allgemeine Wärme, für unseren Interaktionsstil, unsere Problemlösekompetenzen und eben auch für unser Streitverhalten. Sogar extrem destruktive Verhaltensweisen werden von einer Generation zur Nächten weitergegeben, also beispielsweise häusliche Gewalt. Wenn es in der Herkunftsfamilie zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen ist, dann steigt das Risiko für Gewalt in der eigenen Partnerschaft auf das doppelte bis dreifache. Und das obwohl die Menschen, die Gewalt in ihrer Familie erlebt haben, darunter sehr gelitten haben.
 Unser Elternhaus beeinflusst also unser Streitverhalten. Gilt das für Männer und Frauen gleichermaßen?
Unser Elternhaus beeinflusst also unser Streitverhalten. Gilt das für Männer und Frauen gleichermaßen?
Im Prinzip ja. Trotzdem gibt es Unterschiede. Kleine Mädchen lernen von beiden Elternteilen, von der Mutter als Rollenvorbild aber auch vom Vater als Interaktionspartner. Später neigen sie dann dazu, sich in Konflikten ähnlich zu verhalten, wie sie es schon als Kind den Eltern gegenüber taten. Es besteht also eine gewisse Verhaltenskonsistenz. Bei Männern ist das anders.
Inwiefern?
Männer erleben in einer Liebesbeziehung einen größeren Rollenwechsel. Die Rolle des kindlichen Sohnes passt nicht in das Bild, das wir vom autonomen männlich-starken Liebhaber haben. Deshalb spielt die Mutter -Sohn Beziehung hier auch keine so große Rolle. Männer orientieren sich eher am Vorbild des Vaters. Wenn der also beim Streit mit der Faust auf den Tisch schlug oder aber den inneren Rückzug antrat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich der Sohn später ähnlich verhält.
Eine destruktiver Streitkultur im Elternhaus kann also böse Folgen haben für die eigene Beziehung
Eindeutig. Beispiel Scheidungsrisiko. Das überträgt sich von einer Generation zur nächsten. Sogar eine Scheidung der Großeltern hat noch Wirkung auf das eigene Scheidungsrisiko. Und diese Effekte sind nicht gering. Wenn Ihre Eltern geschieden sind, dann steigt ihr eigenes Scheidungsrisiko schon um das 1,3 fache. Und wenn Sie dann auch noch einen Partner haben, der eine Scheidung seiner Eltern erlebt hat, dann haben Sie schon ein dreifach erhöhtes Scheidungsrisiko.
Trennung ist häufig die Konsequenz von destruktivem Streitverhalten. Was genau verstehen Sie darunter?
Typische Killerverhalten sind zum Beispiel die Verallgemeinerung von Vorwürfen und Kritik sowie die Bereitschaft, den jeweils Anderen als Person abzuwerten. Sehr destruktiv wirkt auch, wenn sich einer der beiden Partner wortlos zurückzieht. Und natürlich dazu passend – die gezielte Provokation. Im Zusammenspiel führt das zur Eskalation.
Ein typisches Beispiel ist die sogenannte Forderungs-Rückzugsspirale
Forderungs-Rückzugsspiralen sind ein häufiges Muster, das vor allem dann auftritt, wenn Partner-Konflikte sich bereits verhärtet haben. Dabei versucht ein Partner, z.B. die Frau einen Konflikt-Thema anzusprechen, der Mann fühlt sich bedrängt und zieht sich zurück. Durch den Rückzug des Mannes fühlt sich die Frau gekränkt und reagiert noch resoluter, dadurch zieht sich der Partner noch mehr zurück usw. Es entsteht ein Teufelskreis und am Ende sagt der eine ich würd ja nicht so nörgeln, wenn Du mir endlich zuhören würdest und der andere sagt ich würde Dir ja zuhören, wenn Du nicht ständig so nörgeln würdest. Das ist ein Muster mit einer hohen Eigendynamik.
Meist sind es die Männer, die sich zurückziehen, warum?
Ursache sind zum einen unterschiedliche Beziehungskonzepte. Frauen gehen eher davon aus, dass eine Beziehung dann in Ordnung ist, wenn sie über Probleme noch reden können. Die Männer finden eine Beziehung eher dann in Ordnung, wenn sie nicht über Probleme reden müssen. Hinzu kommt, dass Männer sich schneller von ihren Gefühlen überflutet fühlen, ihr Rückzug hat dann eher eine Schutzreaktion. Außerdem spielt die Herkunftsfamilie eine Rolle. Die Wahrscheinlichkeit für gesprächsvermeidendes Verhalten steigt, wenn der Vater sich ebenfalls in Konflikten zurückgezogen hat. Es fehlen alternative Rollenvorbilder.
Hinzu kommen dann aber auch noch die Erfahrungen der Frau in ihrer eigenen Herkunftsfamilie
Stimmt. Wir haben festgestellt, dass Frauen überdurchschnittlich häufig einen Partner wählen, der ein Rückzugsverhalten zeigt, das dem Verhalten ihres Vaters ähnelt. Und wenn diese Frauen dann den Rückzug in ihrer Partnerschaft erleben, fühlen sie sich davon möglicherweise besonders verletzt. In diesem Fall ist das Risiko für die Forderungs-Rückzugspiralen besonders hoch.
Wie hoch ist denn der Einfluss der Herkunftsfamilie auf unser Konfliktverh
alten? Kann man das in Zahlen ausdrücken?
Im Durchschnitt können wir aus dem Verhalten der Herkunftsfamilie etwa 20 30 Prozent des Paarverhaltens vorhersagen. Das sind eher mittlere Zusammenhänge keine riesigen, aber sie sind eindeutig nachweisbar.
Das heißt, wir sind auch selbst verantwortlich?
Klar, um es mal so zu sagen: Die Herkunftsfamilie spielt eher die Hintergrundmusik der Paarbeziehung. Ob wir in Dur oder in Moll spielen, das entscheiden wir schon selbst als Paar. Wichtig ist zum Beispiel die Erkenntnis, dass negative Verhaltensweisen unseres Partners, wie Nörgeln, Rückzug oder Aggression immer auch durch unser eigenes negatives Verhalten mit ausgelöst wird. Dieser Auslösefaktor beträgt immerhin ca. 25 Prozent. Unser eigenes negatives Verhalten hat also eine hohe Ansteckungsgefahr.
Leider im Gegensatz zu positivem Verhalten. Das wirkt lange nicht so ansteckend, warum?
Vermutlich aus neurobiologischen Gründen. Bei negativen Verhaltensweisen sind sofort negative Emotionen im Spiel. Wenn uns einer unfreundlich behandelt, reagieren wir darauf geradezu automatisch. Im Gegensatz zu konstruktivem Verhalten. Das müssen wir immer wieder aus eigener Kraft an den Tag legen. Wir müssen also in der Lage sein unsere Emotionen kognitiv zu regulieren.
Es sind höhere Hirnfunktionen gefragt
Ja, wir müssen eine bewusste Entscheidung für positives Verhalten treffen, auch wenn sich der Erfolg nicht unmittelbar einstellt. Das erklärt auch die berühmte 5 zu 1 Kostante des amerikanischen Paarforschers John Gottman. Demnach braucht es mindestens fünf positive Gesten, um eine negative Interaktionssequenz auszugleichen. Paare, die das nicht mehr schaffen, trennen sich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
Um das zu verhindern, brauchen wir also konstruktive Streit-Techniken. Was hilft konkret?
Das Wichtigste ist Zuzuhören, also Aufmerksamkeit zu schenken und sich Zeit lassen, die Position des Gegenübers zu verstehen. Dann müssen wir in der Lage sein zu verhandeln und Kompromisse zu schließen. Wer seine Position immer zu 100 durchsetzen will, macht den anderen zum hundertprozentigen Verlierer. Das möchte keiner sein. Und natürlich gehört Respekt dazu, auch wenn ich auf der Sachebene unterschiedlicher Meinung bin. Also Respekt, Achtsamkeit, Akzeptanz und nicht zuletzt die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln und sich in die Position des anderen hineinversetzen zu können. Und zwar nicht nur kognitiv sondern auch emotional. Wenn das beiden Partnern gelingt, sprechen wir von einer positiven Streitkultur.
Und das kann man hinkriegen trotz familiärer Belastung?
Durchaus. Das kann man lernen. Wir sind immer auch eigenständige Gestalter unserer Beziehungen. Wichtig ist nur, dass man sich die familiären Muster bewusst macht, um sich dagegen wehren zu können.
15. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
15. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
Sprachliche Umwelten körperlicher Erkrankungen. Ein Beitrag zu einer systemischen Familienmedizin
I n den 90er Jahren befasste sich eine Osnabrücker Arbeitsgruppe mit familiendynamischen Konzepten der Betreuung asthmakranker Kinder und ihrer Familien, zu der auch Arist von Schlippe gehörte. Dieser veröffentlichte in der systhema 1/1999 einen Beitrag, in dem die Erfahrungen dieser Gruppe reflektiert wurden. In seiner Vorbemerkung heißt es:„Die hier entwickelten Überlegungen spiegeln meine Erfahrungen im Rahmen der Osnabrücker Arbeitsgruppe wieder, in der mit dem Luftiku(r)s-Konzept ein familien- und verhaltensmedizinisches Modell zur Betreuung asthmakranker Kinder und ihrer Familien entwickelt wurde (
). Sie sind in dieser Form das Ergebnis intensiven Austausches innerhalb dieser Arbeitsgruppe. An diese Erfahrungen möchte ich allgemeinere Überlegungen darüber anschließen, wie soziale Systeme Wirklichkeiten um chronische Krankheiten herumbauen. Neben einem allgemeinen Modell zum Verständnis der systemischen Prozesse chronischer Erkrankungen werde ich dabei auch eine persönliche Geschichte erzählen. Es ist u.a. eine Geschichte meines Abschieds von einem heimlichen Hochmut: ‚eigentlich sind alle, auch die körperlichen Krankheiten im Grunde psychologischer Natur’ und es ist eine Geschichte meines Friedens mit der Perspektive der Schulmedizin und mit den Medizinern, der sich in vielen Fällen zur Freundschaft weiterentwickelt hat. Es freut mich gleichzeitig, wenn ich von meinen Medizinerkollegen höre, dass es auch für sie so ist, dass die Kooperation mit anderen Berufsgruppen in unserem Projekt ihre Arbeit im medizinischen Alltag verändert hat“
n den 90er Jahren befasste sich eine Osnabrücker Arbeitsgruppe mit familiendynamischen Konzepten der Betreuung asthmakranker Kinder und ihrer Familien, zu der auch Arist von Schlippe gehörte. Dieser veröffentlichte in der systhema 1/1999 einen Beitrag, in dem die Erfahrungen dieser Gruppe reflektiert wurden. In seiner Vorbemerkung heißt es:„Die hier entwickelten Überlegungen spiegeln meine Erfahrungen im Rahmen der Osnabrücker Arbeitsgruppe wieder, in der mit dem Luftiku(r)s-Konzept ein familien- und verhaltensmedizinisches Modell zur Betreuung asthmakranker Kinder und ihrer Familien entwickelt wurde (
). Sie sind in dieser Form das Ergebnis intensiven Austausches innerhalb dieser Arbeitsgruppe. An diese Erfahrungen möchte ich allgemeinere Überlegungen darüber anschließen, wie soziale Systeme Wirklichkeiten um chronische Krankheiten herumbauen. Neben einem allgemeinen Modell zum Verständnis der systemischen Prozesse chronischer Erkrankungen werde ich dabei auch eine persönliche Geschichte erzählen. Es ist u.a. eine Geschichte meines Abschieds von einem heimlichen Hochmut: ‚eigentlich sind alle, auch die körperlichen Krankheiten im Grunde psychologischer Natur’ und es ist eine Geschichte meines Friedens mit der Perspektive der Schulmedizin und mit den Medizinern, der sich in vielen Fällen zur Freundschaft weiterentwickelt hat. Es freut mich gleichzeitig, wenn ich von meinen Medizinerkollegen höre, dass es auch für sie so ist, dass die Kooperation mit anderen Berufsgruppen in unserem Projekt ihre Arbeit im medizinischen Alltag verändert hat“
Zum vollständigen Text
12. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
Psychosoziale Beratung im Spiegel soziologischer Theorien
In einem Artikel für die„Zeitschrift für Soziologie“ aus dem Jahre 2006 beschäftigt sich Ruth Großmaß, seit 2004 Professorin für Ethik an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin mit unterschiedlichen soziologischen Perspektiven auf die Funktion und Bedeutung psychosozialer Beratung in der Gesellschaft:„Beratung ist heute eine ubiquitäre Alltagspraxis und zugleich ein Angebot professioneller Beratungseinrichtungen. Der Artikel untersucht die letzteren unter dem Gesichtspunkt, welche Bedeutung sie innerhalb von Struktur und Entwicklung westlicher Gesellschaften haben. Drei Gesellschaftstheorien die Luhmanns, Bourdieus und Foucaults werden herangezogen, um jeweils unterschiedliche Aspekte dieser Innovation des 20. Jahrhunderts zu beleuchten. Hierbei erweist sich Beratung als ein soziales System, das Inklusion hinsichtlich der gesellschaftlichen Funktionssysteme unterstützt, als ein Feld beruflicher Konkurrenz, das Diskurse der Selbstmodifikation produziert, und als eine neue Form der Technologien des Selbst. Darüber hinaus wird deutlich, dass Beratungseinrichtungen interessante Untersuchungsfelder sind, um neuere gesellschaftliche Entwicklungen dort zu studieren, wo sie die Individuen und ihr Alltagleben erreichen“ Der Text ist auch online zu lesen,
und zwar hier
11. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
How Animals Eat Their Food
9. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
Problem – „Bindeglied“ klinischer Systeme
 1988 erschien im Springer-Verlag ein von Ludwig Reiter, Ewald J. Brunner und Stella Reiter-Theil herausgegebener Sammelband, dessen paradigmatischer Titel„Von der Familientherapie zur systemischen Perspektive“ die inhaltlichen Umbrüche im psychotherapeutischen Feld der frühen 80er Jahre gut zum Ausdruck brachte. Da das Buch in sehr kleiner Auflage erschien, war es für damalige Verhältnisse recht kostspielig und dürfte (trotz vieler Zitationen) nicht allzu viele Leser gehabt haben. In diesem Band, der 1997 eine (letzte) Neuauflage als Paperback erfuhr, ist auch ein Text von Kurt Ludewig enthalten, in dem er seine Vorstellungen der„Grundzüge eines systemischen Verständnisses psychosozialer und klinischer Probleme“ entfaltet:„Dieser Beitrag erkundet in Anlehnung an zeitgenössische erkenntnis- und systemtheoretische Auffassungen Sinn und Nutzen des Konzepts„Problem“ (bzw.„Problemsystem“) als Ausdruck für ein interaktionelles, sprich systemisches Geschehen für die klinische Praxis im psychosozialen Bereich. Er trägt Grundzüge einer Sichtweise zusammen, wonach das„Hervorbringen“ (s. unten) klinischer Probleme (sonst Symptome oder psychische Krankheiten genannt) nicht als bloßes, noch so geschultes Konstatieren angeblicher Fakten, sondern als Aktivität eines Klinikers betrachtet wird, die auf diesen zurückverweist und ihn daher unvermeidlich mit definiert“ Der Beitrag ist nun in der Systemischen Bibliothek des systemagazin zu lesen,
1988 erschien im Springer-Verlag ein von Ludwig Reiter, Ewald J. Brunner und Stella Reiter-Theil herausgegebener Sammelband, dessen paradigmatischer Titel„Von der Familientherapie zur systemischen Perspektive“ die inhaltlichen Umbrüche im psychotherapeutischen Feld der frühen 80er Jahre gut zum Ausdruck brachte. Da das Buch in sehr kleiner Auflage erschien, war es für damalige Verhältnisse recht kostspielig und dürfte (trotz vieler Zitationen) nicht allzu viele Leser gehabt haben. In diesem Band, der 1997 eine (letzte) Neuauflage als Paperback erfuhr, ist auch ein Text von Kurt Ludewig enthalten, in dem er seine Vorstellungen der„Grundzüge eines systemischen Verständnisses psychosozialer und klinischer Probleme“ entfaltet:„Dieser Beitrag erkundet in Anlehnung an zeitgenössische erkenntnis- und systemtheoretische Auffassungen Sinn und Nutzen des Konzepts„Problem“ (bzw.„Problemsystem“) als Ausdruck für ein interaktionelles, sprich systemisches Geschehen für die klinische Praxis im psychosozialen Bereich. Er trägt Grundzüge einer Sichtweise zusammen, wonach das„Hervorbringen“ (s. unten) klinischer Probleme (sonst Symptome oder psychische Krankheiten genannt) nicht als bloßes, noch so geschultes Konstatieren angeblicher Fakten, sondern als Aktivität eines Klinikers betrachtet wird, die auf diesen zurückverweist und ihn daher unvermeidlich mit definiert“ Der Beitrag ist nun in der Systemischen Bibliothek des systemagazin zu lesen,
und zwar hier
6. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
Psychotherapie im Dialog?

Die„Psychotherapie im Dialog“ erscheint nun im 14. Jahrgang als Zeitschrift für„Psychodynamische Therapie [jetzt nicht mehr Psychoanalyse, T.L.], Systemische Therapie, Verhaltenstherapie, Humanistische Therapien“, ein Grund für den Verlag, Marktforschung zu betreiben, weil sich offenbar die„Leserwünsche verändert“ haben. Das Eingangseditorial von Michael Broda beginnt mit dem Spruch„Nicht, was der Zeit widersteht, ist dauerhaft, sondern das, was sich klugerweise mit ihr ändert“. Das hört sich ein bisschen nach Notwehr an. Hat die Redaktion womöglich ein Angebot bekommen, das sie nicht ablehnen konnte?
Als Leserwünsche werden„mehr Themenvielfalt“ und„Leserfreundlichkeit“ genannt. Themenvielfalt soll offenbar durch einen neuen Mantel gewährleistet werden, der – in Rosa (mit leserfreundlicher Rosa Schrift auf weißem Grund) gehalten – den klassischen Themenmantel (leserfreundlich in noch hellgrünerer Schrift als bisher auf weißen bzw. etwas noch hellgrünerem Hintergrund) einbindet. In Rosa gibt es zukünftig neue Rubriken, z.B. Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Studien (wer wählt die aus? Und nach welchen Kriterien?), Rechtstipps, aber auch Filmbesprechungen, alles mit großen Stock-Fotos aufgepeppt.
In der Mitte des Heftes finden wir dann den gewohnten Themenkern. Hier wird die Drohung im Editorial, dass„ab diesem Heft (
) alle Texte nicht nur redaktionell, wie bisher, sondern auch sprachlich überarbeitet und im neuen Layout gesetzt“ werden, wahr gemacht. Zunächst wundert sich der Leser natürlich, der bislang unter einer redaktionellen selbstverständlich auch eine sprachliche Überarbeitung verstanden hat. Nun lässt sich der sprachliche Eingriff nicht überprüfen, wenn die ursprünglichen Manuskripte nicht vorliegen. Feststellen lässt sich aber, dass alle Texte nun in eine Form gepresst werden, die schon bemerkenswert ist. Wer früher dachte, dass die PID mit ihren vielen kurzen dreispaltigen Texten, die durch viele Zwischenüberschriften untergliedert wurden, schon den Gipfel der Magazinhaftigkeit erreicht hätte, wird nun eines besseren belehrt. Mehr Magazin geht nicht. Dem Leser wird nun grundsätzlich nicht mehr zugetraut, mehr als zwei Absätze ohne Zwischenüberschrift zu lesen. Die Lesefreundlichkeit wird auch dadurch gesteigert, dass aus den schwarzen bzw. dunkelgrünen Zwischenüberschriften der früheren Hefte nun einheitlich hellgrüne Zwischenüberschriften geworden sind, immerhin eine Möglichkeit, das Kontrastauflösungsvermögen der eigenen Augen zu überprüfen. Damit man nicht bei soviel Übersichtlichkeit verloren geht, werden vermeintlich besonders wichtige Aussagen noch einmal in fett und hellgrün in den Text hineingesetzt, eingerahmt in hellgrüne Linien. An Kästchen, Einrahmungen usw., kurz: der ganzen Layout-Pest, mit der man heutzutage zugemüllt wird, ist also kein Mangel. Wer sich mit dem Fließtext, der bei allem Layout noch übrig geblieben ist, immer noch überfordert fühlt, kann dann auf Spiegelstriche rechnen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und alle Spiegelstriche der beiden letzten Hefte zusammengezählt. Während das Heft 4/2012 (Sucht) insgesamt auf 68 Spiegelstriche kommt, sind die in der aktuellen Ausgabe schon auf Seite 29 erreicht. Insgesamt habe ich sage und schreibe 425 Spiegelstriche gefunden, also eine Steigerung um 525 %!
Die Lesefreundlichkeit soll auch durch eine andere Schrift und einen größeren Zeilenabstand hergestellt werden. Die neue Schrift hat schmalere Buchstaben, was m.E. den Lesefluss nicht verbessert, statt 62 Zeilen finden sich nun 51 Zeilen in einer Spalte (nicht so einfach, eine Spalte ohne Zergliederung zu finden, bei der man das zählen kann). Da der Umfang des gesamten Heftes konstant geblieben ist, bedeutet das weniger Inhalt, vor allem (aufgrund der Einführung des Mantels) im Themenbereich. Hatte dieser in Heft 4/2012 noch 98 Seiten á 3 Spalten á 62 Zeilen, so besteht er im aktuellen Heft aus 84 Seiten á 3 Spalten á 51 Zeilen – das sind 12.000 Zeilen gegen 18.000, der Platzverlust durch Layout-Klimbim noch gar nicht eingerechnet. Der Thieme-Verlag ist ein Medizinverlag, so verwundert nicht, dass die PID sich nun der Anmutung einer der vielen Arztzeitschriften immer weiter nähert.
Der web-Auftritt bei thieme-connect.de wirkt genauso hell und luftig wie die Printausgabe, ist aber wenig funktional. Um sich Kurzinformationen über die einzelnen Artikel zu verschaffen, muss man nun für jeden Artikel einen Link anklicken, ansonsten bekommt man nur Autorennamen und Überschriften (das war früher sehr viel besser!). Will man die Daten in eine Literaturdatenbank einpflegen, ist das mit jeder Menge lästiger Arbeit verbunden. Schlampig an der aktuellen Ausgabe ist, dass ein Text von Martin Sack und Barbara Gromes im Online-Inhaltsverzeichnis einfach vergessen wurde und daher auch nicht heruntergeladen werden kann. Das größte Ärgernis der vergangenen Ausgaben, der stärkste Angriff auf die Leserfreundlichkeit ist aber immer noch nicht behoben, nämlich die Praxis, im Text angegebene Literaturquellen (bei damit verbundenem Seitenumbruch) nicht am Ende des Textes abzudrucken, sondern auf eine Datei im Internet zu verweisen, die noch nicht einmal physisch mit dem PDF des jeweiligen Artikels verbunden ist. Im Unterschied zu früher sind die Quellen noch nicht einmal als HTML-Datei direkt zu sehen, man muss eine PDF-Datei laden. Mit ist bis heute nicht klar, warum die Herausgeber diese einmalige Missachtung von Autoren wie Lesern dulden. Der Verlag teilte mir auf Anfrage dazu übrigens mit:„Der wissenschaftlich lesend und arbeitenden Abonnent unserer Zeitschriften bewegt sich den ganzen Tag im Internet, so dass de Hürde des Medienwechsels nicht mehr als solche wahrnehmbar ist, wie es vielleicht vor 5 Jahren noch der Fall war. Es gibt übrigens auch Journals, bei denen die kompletten Literaturverzeichnisse nur im Internet stehen und gar nicht mehr in der Print-Fassung abgedruckt sind. Soweit wollen wir bei der PiD aber vorerst nicht gehen“.
Das aktuelle Thema lautet„Resilienz und Ressourcen“. Auch hier gibt es wieder eine bunte Mischung aus Beiträgen von Vertretern der verschiedenen Therapierichtungen. In den letzten Jahren konnte man den Eindruck gewinnen, dass womöglich langsam die Themen ausgehen. Nachdem die meisten Störungsbilder als Themen vorgekommen sind, kommen manche nun in eine zweite Runde. Daneben gab es in letzter Zeit viele Hefte, in denen in erster Linie (wissenswerte) Informationen vermittelt wurden, die sicherlich für Psychotherapeuten auch relevant sind (Psychokardiologie, Anfälle, Schlaf, Patientenautonomie etc.). Die spannende Frage aber ist, ob irgendwann auch noch einmal damit zu rechnen ist, dass die Zeitschrift ihrem Titel gerecht wird und – anstatt nur additiv schulenspezifische Texte nebeneinander zu stellen – Psychotherapie in einen Dialog bringt. Oder gibt es da etwa gar nichts mehr zu diskutieren?
Sich„klugerweise“ mit der Zeit zu ändern, mag vielleicht zu mehr Dauer führen, ob das auch zu einer Verbesserung führt, bleibt abzuwarten. Etwas mehr Gedanken und etwas weniger Checklisten tätig sicher gut.
Zu den vollständigen abstracts der aktuellen Ausgabe
6. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
System und Kultur
Das letzte Heft des Kontext war noch einmal dem Thema der DGSF-Jahrestagung„Dialog der Kulturen“ gewidmet und wurde mit einem theoretisch orientierten Beitrag von Tom Levold eröffnet, der sich mit der Frage beschäftigte,„Warum sich Systemiker mit Kultur beschäftigen sollten“. Im Wissensportal der DSGF ist dieser Text online zu lesen. Im abstract heißt es:„Nach einigen grundlegenden Bemerkungen zum Kulturbegriff werden einige Konzepte der Kulturtheorie vorgestellt, die sich seit dem 18. Jahrhundert entwickelt haben. Für den gegenwärtigen Kulturdiskurs sind dabei vor allem bedeutungsorientierte Kulturkonzepte relevant. Anschließend wird der Kulturbegriff in Niklas Luhmanns Systemtheorie mit einem praxeologischen Kulturbegriff kontrastiert, um die Frage zu untersuchen, ob sich daraus ein Potenzial für eine systemische Praxeologie ableiten lässt. Abschließend wird postuliert, dass eine therapeutische Praxis als interkulturelle Begegnung gelingen kann, wenn sie Kultur als spannungsreiche Trias von symbolischer Ordnung, Diskurs und Praxis begreift“
Zum vollständigen Text
5. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
Führung
Die neue Ausgabe der„Konfliktdynamik“ beschäftigt sich ganz mit dem Thema Führung in Zeiten postheroischen Managements. Heinz Stahl und Hans Rudi Fischer machen in ihrem Opener deutlich:„Wer unter Bedingungen hoher Komplexität, hoher Kontingenz und Volatilität führen will, muss versuchen, scheinbar unvereinbare Gegenpole zu synthetisieren, statt sich immer auf eine Seite zu schlagen. Die Unversöhnlichkeit von Gegensatzpaaren kann durch Ausbalancieren aufgelöst werden. Die neue Führungskraft wird so zum Seiltänzer, der ein dynamisches Gleichgewicht halten muss und kann“ Das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Heftes und
alle abstracts finden Sie hier
4. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
Therapie von Online-Sucht systemisches Phasenmodell
 Franz Eidenbenz befasst sich seit über 10 Jahren mit psychologischen Fragen im Zusammenhang mit neuen Medien. Er ist in privater Praxis tätig und seit 2011 Leiter Behandlung des Zentrums für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte in Zürich. In der Open-Access-Zeitschrift Psychotherapie-Wissenschaft hat er in Heft 2/2012 einen Beitrag mit dem Thema„Therapie von Online-Sucht systemisches Phasenmodell“ veröffentlicht. Im abstract heißt es:„Online-Sucht wird unter anderem als Kommunikations-, Beziehungs- oder Bindungsstörung verstanden, bei der sich Jugendliche aufgrund von innerfamiliären Kommunikationsproblemen und ungelöster Konflikte, hinter den Bildschirm zurückziehen. Die Familie wird als Kerngruppe gesehen, in der neue Modelle von Handlungsmustern und konstruktiven Konfliktlösungsmöglichkeiten erarbeitet werden können. Dementsprechend wird ein systemisches Phasenmodell für die Therapie vorgeschlagen bei dem das Umfeld als Ressource genutzt wird. Der Therapieprozess wird anhand von vier Phasen beschrieben: Initialphase, Motivationsphase, Vertiefungsphase, Stabilisierungs- und Abschlussphase“
Franz Eidenbenz befasst sich seit über 10 Jahren mit psychologischen Fragen im Zusammenhang mit neuen Medien. Er ist in privater Praxis tätig und seit 2011 Leiter Behandlung des Zentrums für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte in Zürich. In der Open-Access-Zeitschrift Psychotherapie-Wissenschaft hat er in Heft 2/2012 einen Beitrag mit dem Thema„Therapie von Online-Sucht systemisches Phasenmodell“ veröffentlicht. Im abstract heißt es:„Online-Sucht wird unter anderem als Kommunikations-, Beziehungs- oder Bindungsstörung verstanden, bei der sich Jugendliche aufgrund von innerfamiliären Kommunikationsproblemen und ungelöster Konflikte, hinter den Bildschirm zurückziehen. Die Familie wird als Kerngruppe gesehen, in der neue Modelle von Handlungsmustern und konstruktiven Konfliktlösungsmöglichkeiten erarbeitet werden können. Dementsprechend wird ein systemisches Phasenmodell für die Therapie vorgeschlagen bei dem das Umfeld als Ressource genutzt wird. Der Therapieprozess wird anhand von vier Phasen beschrieben: Initialphase, Motivationsphase, Vertiefungsphase, Stabilisierungs- und Abschlussphase“
Zum vollständigen Text geht es hier
2. April 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare
Jetzt 5.000 Mitglieder in der DGSF organisiert
 Köln, 27.3.2013: Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) ist einer der größten psychosozialen Fachverbände in Deutschland mit einer dynamischen Mitgliederentwicklung: Im März hat der Verband sein 5000. Mitglied aufgenommen. Damit hat die DGSF ihre Mitgliederzahl in weniger als zwei Jahren um 25 Prozent gesteigert. Erst im September 2011 konnte der Verband bei seiner wissenschaftlichen Jahrestagung in Bremen sein 4000. Mitglied begrüßen. Bei seiner Gründung im Jahr 2000 hatte der Verband aus dem Zusammenschluss von zwei Vorgängerverbänden DAF (Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Familientherapie) und DFS (Dachverband für Familientherapie und systemisches Arbeiten) entstanden zunächst rund 1300 Mitglieder. Die DGSF tritt ein für die fachliche Weiterentwicklung der Systemischen Therapie, Beratung und Familientherapie in Theorieentwicklung und Forschung, Aus- und Weiterbildung, psychosozialer Versorgungspraxis, Berufs- und Sozialpolitik. Ihre Mitglieder sind Pädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen, Mediziner, Theologen und andere Fachleute. Sie arbeiten im Gesundheitswesen, in der Sozialen Arbeit und Jugendhilfe, in der Rehabilitation, in der Arbeitsverwaltung, in der Unternehmens- und Politikberatung, in den Kirchen und weiteren Kontexten. Der Verband unterhält eine Geschäftsstelle in Köln und hat kürzlich einen Forschungsfonds in Höhe von 140.000 Euro eingerichtet. Damit möchte er Forschungsprojekte anregen zur Wirksamkeit systemischer Therapie und Beratung im Gesundheitswesen und in der Jugendhilfe. Der Verband vergibt Zertifikate für systemisch weitergebildete Fachleute, ein Empfehlungs-Siegel für systemisch-familienorientiert arbeitende Einrichtungen und zertifiziert systemische Weiterbildungsgänge. Seit 2005 verleiht die DGSF alle zwei Jahre einen Forschungspreis.
Köln, 27.3.2013: Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) ist einer der größten psychosozialen Fachverbände in Deutschland mit einer dynamischen Mitgliederentwicklung: Im März hat der Verband sein 5000. Mitglied aufgenommen. Damit hat die DGSF ihre Mitgliederzahl in weniger als zwei Jahren um 25 Prozent gesteigert. Erst im September 2011 konnte der Verband bei seiner wissenschaftlichen Jahrestagung in Bremen sein 4000. Mitglied begrüßen. Bei seiner Gründung im Jahr 2000 hatte der Verband aus dem Zusammenschluss von zwei Vorgängerverbänden DAF (Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Familientherapie) und DFS (Dachverband für Familientherapie und systemisches Arbeiten) entstanden zunächst rund 1300 Mitglieder. Die DGSF tritt ein für die fachliche Weiterentwicklung der Systemischen Therapie, Beratung und Familientherapie in Theorieentwicklung und Forschung, Aus- und Weiterbildung, psychosozialer Versorgungspraxis, Berufs- und Sozialpolitik. Ihre Mitglieder sind Pädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen, Mediziner, Theologen und andere Fachleute. Sie arbeiten im Gesundheitswesen, in der Sozialen Arbeit und Jugendhilfe, in der Rehabilitation, in der Arbeitsverwaltung, in der Unternehmens- und Politikberatung, in den Kirchen und weiteren Kontexten. Der Verband unterhält eine Geschäftsstelle in Köln und hat kürzlich einen Forschungsfonds in Höhe von 140.000 Euro eingerichtet. Damit möchte er Forschungsprojekte anregen zur Wirksamkeit systemischer Therapie und Beratung im Gesundheitswesen und in der Jugendhilfe. Der Verband vergibt Zertifikate für systemisch weitergebildete Fachleute, ein Empfehlungs-Siegel für systemisch-familienorientiert arbeitende Einrichtungen und zertifiziert systemische Weiterbildungsgänge. Seit 2005 verleiht die DGSF alle zwei Jahre einen Forschungspreis.
31. März 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare