 Heute wäre Jay Haley (Foto: Wikipedia) 90 Jahre alt geworden. Er war einer der Gründer des Mental Research Institutes MRI in Palo Alto und einer der wichtigsten Pioniere der Familientherapie und systemischen Therapie. Ursprünglich als Theaterwissenschaftler und Bibliothekar ausgebildet (einer Qualifikation, die ihn heutzutage von jeder psychotherapeutischen Ausbildung ausgeschlossen hätte), fand er Anschluss an die Gruppe um Gregory Bateson, die sich in Kalifornien der Untersuchung zwischenmenschlicher Kommunikation widmete. Gemeinsam mit John Weakland untersuchte er die therapeutische Arbeit von Milton Erickson, Joseph Wolpe, John Rosen, Don J. Jackson, Frieda Fromm-Reichmann. Als Gründungsherausgeber brachte er eine der maßgeblichsten Zeitschriften im familientherapeutischen Feld, die„Family Process“ auf den Weg. Als einer der Pioniere des strategischen Ansatzes in der Familientherapie vertrat er die Verbindung eines systemisches Verständnisses von Kommunikation mit einem pragmatischen Interventionskonzept, das großen Einfluss auf die Entwicklung der systemischen Therapie in ihrer Anfangsphase hatte. Auch wenn seine Arbeiten im Zuge der konstruktivistischen Wende der Systemischen Therapie in den 80er Jahren allmählich an Stellenwert verloren, sind sie auch heute noch unbedingt lesens- und nachdenkenswert. Sein provokanter und humorvoller Stil bietet auf zeitlose Weise Gelegenheit, auch die eigene (system)therapeutische Praxis immer wieder in Frage zu stellen. Auf der website, die seinem Gedächtnis gewidmet ist, findet sich ein„Quiz for young therapists“, das ein gutes Beispiel für seine unkonventionelle Denkweise liefert – und das man sich zu Ehren seines 90. Geburtstages mit Vergnügen durchlesen kann.
Heute wäre Jay Haley (Foto: Wikipedia) 90 Jahre alt geworden. Er war einer der Gründer des Mental Research Institutes MRI in Palo Alto und einer der wichtigsten Pioniere der Familientherapie und systemischen Therapie. Ursprünglich als Theaterwissenschaftler und Bibliothekar ausgebildet (einer Qualifikation, die ihn heutzutage von jeder psychotherapeutischen Ausbildung ausgeschlossen hätte), fand er Anschluss an die Gruppe um Gregory Bateson, die sich in Kalifornien der Untersuchung zwischenmenschlicher Kommunikation widmete. Gemeinsam mit John Weakland untersuchte er die therapeutische Arbeit von Milton Erickson, Joseph Wolpe, John Rosen, Don J. Jackson, Frieda Fromm-Reichmann. Als Gründungsherausgeber brachte er eine der maßgeblichsten Zeitschriften im familientherapeutischen Feld, die„Family Process“ auf den Weg. Als einer der Pioniere des strategischen Ansatzes in der Familientherapie vertrat er die Verbindung eines systemisches Verständnisses von Kommunikation mit einem pragmatischen Interventionskonzept, das großen Einfluss auf die Entwicklung der systemischen Therapie in ihrer Anfangsphase hatte. Auch wenn seine Arbeiten im Zuge der konstruktivistischen Wende der Systemischen Therapie in den 80er Jahren allmählich an Stellenwert verloren, sind sie auch heute noch unbedingt lesens- und nachdenkenswert. Sein provokanter und humorvoller Stil bietet auf zeitlose Weise Gelegenheit, auch die eigene (system)therapeutische Praxis immer wieder in Frage zu stellen. Auf der website, die seinem Gedächtnis gewidmet ist, findet sich ein„Quiz for young therapists“, das ein gutes Beispiel für seine unkonventionelle Denkweise liefert – und das man sich zu Ehren seines 90. Geburtstages mit Vergnügen durchlesen kann.
Zum vollständigen Text
19. Juli 2013
von Tom Levold
Keine Kommentare


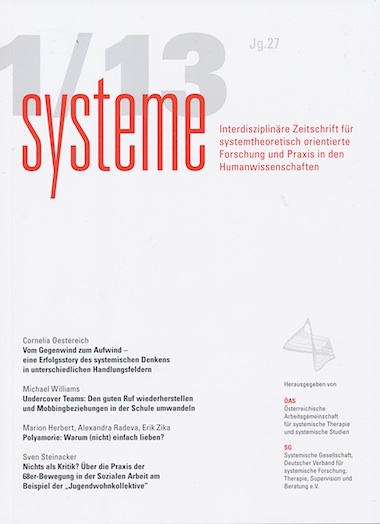





 Der aktuelle„Coaching-Newsletter“ von Christopher Rauen weist auf eine freie Online-Publikation hin, in der Beiträge des Kongresses„Coaching meets Research
Praxisfelder im Fokus“, der im Juni 2012 in Basel stattfand, versammelt sind und die als PDF heruntergeladen werden kann. Themenbereiche sind u.a. Führungskräfte-Coaching, Coaching in der Personalentwicklung, Coaching im Sport, Gesundheitscoaching, Coaching in Wissenschaft und Politik, Etablierung von Coaching in Organisationen, Coaching-Kultur u.v.a. Die Beiträge stammen von namhaften Autorinnen und Autoren wie Heidi Möller, Simone Kauffeld, Uwe Böning, Christoph Schmidt-Lellek, Harald Geißler, Thomas Jägers und anderen. Den Download-Link zu diesen Materialien
Der aktuelle„Coaching-Newsletter“ von Christopher Rauen weist auf eine freie Online-Publikation hin, in der Beiträge des Kongresses„Coaching meets Research
Praxisfelder im Fokus“, der im Juni 2012 in Basel stattfand, versammelt sind und die als PDF heruntergeladen werden kann. Themenbereiche sind u.a. Führungskräfte-Coaching, Coaching in der Personalentwicklung, Coaching im Sport, Gesundheitscoaching, Coaching in Wissenschaft und Politik, Etablierung von Coaching in Organisationen, Coaching-Kultur u.v.a. Die Beiträge stammen von namhaften Autorinnen und Autoren wie Heidi Möller, Simone Kauffeld, Uwe Böning, Christoph Schmidt-Lellek, Harald Geißler, Thomas Jägers und anderen. Den Download-Link zu diesen Materialien