1996 erschien in der ersten Auflage ein Sammelband zur Familiendiagnostik, herausgegeben von Manfred Cierpka, der 2017 verstorben ist. Aktuell ist die 4. Auflage erschienen, vollständig überarbeitet und runderneuert, als Herausgeber sind Günter Reich, Michael Stasch und Joachim Walter hinzugekommen. Wolf Ritscher hat das Buch für systemagazin gelesen und steuert eine ausführliche Rezension bei. Er empfiehlt den Band nicht nur als unverzichtbare Quelle für Neueinsteiger in das familientherapeutische Feld wie auch für darin schon langjährig tätigen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch als Bereicherung für die Arbeit der Vertreter anderer Therapierichtungen, in der Psychiatrie, der Sozialarbeit und der Sozialpädagogik.
Wolf Ritscher, Unterreichenbach:
Das vorliegende Buch ist die 4. vollständig überarbeitete Auflage des 1996 zunächst von Manfred Cierpka allein herausgegeben Sammelbandes zur Familiendiagnostik. Die vierte Auflage wurde von Günter Reich, Michael Stasch und Joachim Walter überarbeitet und erweitert. Sie hat gegenüber den ersten drei Auflagen an Umfang zugenommen, weil neuere Entwicklungen in der Familien- und systemischen Therapie im Hinblick auf ihre Relevanz für die Familiendiagnostik integriert werden.
Die theoretische Grundlage bleibt weiterhin das psychodynamisch-mehrgenerationale Modell, das von der „Göttinger Gruppe“ um Eckhard Sperling und Almuth Massing in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts unter Bezugnahme auf die psychoanalytische Psychodynamik, das Konzept der mehrgenerationalen Loyalitäten von Ivan Boszormenyi-Nagy und die auf soziale Systeme fokussierenden Kommunikationstheorien entwickelt wurde.
In der Zusammenarbeit mit Manfred Cierpka, dem Nachfolger von Eckhard Sperling auf der Göttinger Professur für Familientherapie von 1991- 1998, der sich vor allem um die empirische Fundierung der Psychoanalyse, ihre Erweiterung in den systemischen Raum hinein und Präventionsprojekte für Kinder und Jugendliche verdient gemacht hat, war die psychodynamisch-mehrgenerationale und interaktionelle Familiendiagnostik eines der Arbeitsschwerpunkte der „Göttinger Gruppe“.
Eines ihrer wichtigsten Ergebnisse war das 1996 in der ersten Auflage herausgegebene Handbuch der Familiendiagnostik. 1998 wurde Cierpka Nachfolger von Helm Stierlin für die Professur für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie an der Universität Heidelberg. In dieser Zeit erfolgten die 2. und 3. Auflage. Als Manfred Cierpka 2017 leider verstarb, bildete sich für die noch von ihm geplante 4. Auflage eine Arbeitsgruppe um Günter Reich, die in Göttingen die Tradition der psychodynamisch-mehrgenerationalen Familientherapie weiterhin hochhält. Günter Reich, Michael Stasch und Joachim Walter haben sich in dieser Arbeitsgruppe der Herausforderung einer Aktualisierung der ersten Auflagen gestellt – mit einem beeindruckenden Resultat.
Es ist ihnen gelungen, die theoretische und praktische Qualität der ersten Auflagen zu erhalten und zugleich mit einer Vielzahl neu hinzugekommener AutorInnen weitere Perspektiven und theoretische Konzepte zu integrieren, und den LeserInnen eine Fülle neuer, auch praktisch verwertbarer Informationen anzubieten.
In der Einführung stellen die Autoren ihre wichtigsten Voraussetzungen und Perspektiven dar. In der Abkehr von einem objektivistischen Diagnosekonzept gehen die Autoren von der Erkenntnis der „Zweiten Kybernetik“ aus: beide Seiten, KlientInnen und TherapeutInnen/DiagnostikerInnen, sind Teil des „Beobachtungssystems und insofern sind diagnostische Aussagen an die Beziehung in der diagnostischen bzw. therapeutischen Situation gebunden. Darüber hinaus beeinflussen die theoretischen, professionell-praktischen und biographischen Erfahrungen der DiagnostikerInnen (klinische PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen, PsychiaterInnen usw.) deren Beschreibungen, Beurteilungen und Interventionen. Insofern sind im Dialog mit der Familie formulierte Diagnosen zunächst Angebote der TherapeutInnen, und die Familienmitglieder entscheiden letztlich darüber, ob sie diese übernehmen wollen oder nicht: „Die DiagnostikerInnen stellen der Familie ihre eigene ‚Brille‘ zur Verfügung.“ (S. 2) Ob sie diese aufsetzen und wann, bleibt ihre Entscheidung.
Es empfiehlt sich deshalb, im Kontext von Diagnostik und Therapie nicht vom Familiensystem, sondern vom Problemsystem zu sprechen. Denn Problemdefinitionen sind deren Ausgangspunkt und es ist eine der therapeutischen und diagnostischen Kunstfertigkeiten, in dieser Ausgangslage das systemische „Teleskop“ (ein Bild von Helm Stierlin) auf Ressourcen, Lösungen und Reflexionspotentiale zu richten und die Familie wie auch evtl. beteiligte KollegInnen des klinischen Kontextes für diese Perspektive zu motivieren.
Über den therapeutischen Dialog hinaus dienen diagnostische Aussagen auch der Verständigung unter den Fachleuten; aber auch hier gilt, dass es sich nicht um Wahrheitsaussagen handelt, sondern um immer wieder neu prüfbare Hypothesen.
Wenn wir den Aussagen der AutorInnen folgen, sind therapeutische Interventionen und diagnostische Beschreibungen zwei Seiten derselben Medaille: diagnostische Hypothesen sind zugleich Interventionen, weil sie die systemische Entwicklung voranbringen und Interventionen erzeugen neue Hypothesen, die dann als Ausgangspunkte für das weitere Vorgehen diesen können.
Da alle Aussagen, wie es schon die Gestaltpsychologie festgestellt hat, an den Standort und die sich daraus ergebenden Perspektiven gebunden sind, ist der Begriff des „diagnostischen Fensters“ eine zentrale und auch einsichtige theoretische Metapher für das diagnostische Handeln. Wir blicken quasi durch mehr oder weniger offene Fenster auf die familiäre Landschaft und ihre Umgebung – und die DiagnostikerInnen entscheiden, durch welche Fenster sie in welcher Abfolge die familiären Wirklichkeiten/Realitäten in den Blick nehmen wollen.
Die AutorInnen listen mehrere diagnostische Fenster auf: Erstkontakt, Erstgespräch, Probleme und Behandlungsziele der Familie, Ressourcen, Ziele und Indikationsüberlegungen der Therapeuten und die Dokumentation. Durch diese Fenster blicken wir dann auf die familiäre Lebenswelt, die innerfamiliären Erziehungsstile, die Familienstruktur, das untereinander und nach außen gezeigte Verhalten der Familienmitglieder, den kulturellen Kontext, den familiären Lebenszyklus, die transgenerationale Weitergabe der familiären „Buchführung“ (im Sinne von Ivan Boszormenyi-Nagy) und die intrapsychische Dynamik aller Familienmitglieder (hierfür lässt sich auf das Konzept der „Affektlogik“ von Luc Ciompi verweisen).
Schon in dieser kurzen Einführung wird deutlich, dass mit einer solch komplexen Diagnostik einer reduktionistischen Sicht vorgebeugt werden soll, obwohl jede Diagnose (und jedes therapeutische Handeln) notwendigerweise dem Zwang zur Reduktion von Komplexität (im Sinne von Niklas Luhmann) unterliegt.
Der Bauplan des Werkes ist zugleich Programm.
Teil I beschreibt theoretisch basierte Definitionen im Hinblick auf die Familiendiagnostik. Manfred Cierpka gibt hier einen theoriegeleiteten Überblick in der er einen Focus auf das Konzept „Der Diagnostiker – Ein Brillenträger“ legt. Damit sind alle objektivistischen Sichtweisen vom Tisch, ohne das die wissenschaftsbasierte Genauigkeit verloren geht. Im „Drei-Ebenen-Modell“ wird die Familie unter der Perspektive des Subjekts und seiner Psychodynamik, der durch die Subjekte hergestellten kommunikativen Dyaden bzw. Triaden und der Familie als Gesamtsystem diagnostisch beschrieben. Diese Konzeption der Familie und ihrer Teilsysteme basiert auf einer strukturellen systemischen Sichtweise; sie ist nicht konstruktivistisch, sondern lässt sich eher auf Minuchins strukturelles Konzept der Entstehung eines Familiensystems („Holon“) durch die Interaktion seiner familiären Teilsystemen zurückführen.
Teil II legt den Focus auf das Familienerstgespräch. Das erste Zusammenkommen und die von dem therapeutischen Team erfragten Berichte über die Zeit zwischen Anmeldung und dem ersten Termin ermöglichen wichtige diagnostische Hypothesen und damit Zugangswege zu den familiären Wirklichkeiten.
Wie kann der Erstkontakt im Hinblick auf die therapeutische Beziehung gestaltet werden, welche Informationen über die Familie und das im Erstkontakt entstehende Therapiesystem lassen sich erfragen, welche diagnostische Hypothesen lassen sich gewinnen und für den weiteren Therapieprozess nutzen? Wertvoll für den Leser/die Leserin sind die fachlich kommentierten ausschnitthafte Prozessbeschreibungen aus zwei Familiengesprächen, die von Mitgliedern der Göttinger Gruppe geführt wurden. Hier werden die bislang beschriebenen Theorie-Praxis-Konzepte konkret und praktisch.
Teil III richtet den Blick auf die Kontexte der Familiendiagnostik und damit auf die schon erwähnten „diagnostischen Fenster“. Ohne die Verknüpfung der Familie mit ihren sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten, ohne den Blick auf die Wechselwirkung zwischen innerer familiärer Entwicklung und externen äußeren sozialen, politischen, kulturellen ökonomischen Faktoren lassen sich keine hilfreichen diagnostischen Hypothesen bilden. Hier geht es um die Lebenswelt und Lebenslage der Familie, um ihre Alltagsbewältigung und die hierfür vorhandenen Ressourcen. Das ist auch ein zentrales Thema der systemischen Sozialarbeit. Hier haben die Fragen von Armut und Reichtum, Bildungsferne und Bildungsprivilegien, gesellschaftlicher Partizipation und Marginalisierung, Arbeit und Arbeitslosigkeit, und der Zufriedenheit mit dem eigenen Privat- und Arbeitsleben ihren Platz.
Das diesbezügliche Kapitel „Familiäre Lebenswelten“ enthält eine Vielzahl von spannenden Informationen, die zu kennen für die Arbeit mit Familien unerlässlich ist. Das gilt auch für den Umgang mit kulturellen Differenzen, zu denen es ebenfalls ein eigenes Kapitel gibt.
Unter dem Gesichtspunkt von Multiperspektivität gefällt mir besonders, dass sowohl der systemischen Diagnostik im engeren Sinne, als auch der verhaltenstherapeutischen Diagnostik ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Für die systemische Diagnostik wird deren Angebotscharakter für die KlientInnen betont, die Auftragsorientierung und die Ko-produktion von diagnostischen Hypothesen und therapeutischen Prozessen. Darüber ist inzwischen viel zustimmendes gesagt und geschrieben worden und dennoch muss man diese essentials immer wieder selbstreflexiv betonen. In der verhaltenstherapeutischen Diagnostik geht es um die Funktion des Verhaltens in der familiären Interaktion. Die theoretische Basis hierfür liefert das SORCK-Modell – die Verknüpfung von Stimulus (S), dem Körper und Psyche umfassenden Organismus (O), seine Reaktion (R), die Konsequenzen des gezeigten Verhaltens (C) und die Kontingenz (K), d.h. Lerneffekte durch die verschiedenen Formen der Verstärkung. Wenn man dieses Modell nicht schematisch benutzt, sondern für die genaue Beobachtung einzelner aufeinander folgender Verhaltenssequenzen, kann es auch für SystemikerInnen hilfreich sein.
Im Kapitel zur transgenerationalen Perspektive in der Familientherapie wird der Anschluss zu den PionierInnen der Familientherapie hergestellt – u.a. Ivan Boszormenyi-Nagy, Helm Stierlin, Murray Bowen, Theodor Lidz, Monika Mc Goldrick, Evan Imber-Black, Jürg Willi, Lyman Wynne, Eckhardt Sperling. Auch der Bezug zu Sigmund Freud findet sich. Das ist auch gerechtfertigt, denn er hat durchaus familienbezogen und mehrgenerational gedacht, aber der Familie leider keinen eigenen Platz im Therapiesetting zugewiesen. Wie sehr sich die AutorInnen in diesem Teil ihres Buches auf heimischem Terrain befinden, wird auch dadurch deutlich, dass sie auf eine Vielzahl von Untersuchungen und Veröffentlichungen aus ihrer eigenen Arbeitsgruppe verweisen können.
Teil IV befasst sich mit speziellen Konzepten und Theorien aus dem Feld der Entwicklungs- und klinischen Psychologie, deren Verwendung die Familiendiagnostik bunter, differenzierter und reicher macht. Hier werden Erziehungsstile (Carl Rogers, Annemarie u. Reinhardt Tausch) beschrieben, das Konzept der neuen Autorität (Chaim Omer u. Arist v. Schlippe), die Bindungstheorie (John Bowlby, Mary Ainsworth, Karin u. Klaus Grossmann), das Mentalisieren (Peter Fonagy u. Aia Asen), die Beziehung von Eltern und Säuglingen/Kleinkindern (Daniel Stern, Donald Winnicott), und das von Elisabeth Fivaz-Deupersinge u. Antoinette Corborz-Warnery aus systemischer Sicht beforschte „Primäre Dreieck“ von Vater, Mutter und Kind.
All diese Konzepte können uns helfen, aus dem Zusammenspiel von theoretischen Konzepten und der Beobachtung familiärer Kommunikation diagnostische Hypothesen zu bilden. Z.B. lassen sich aus dem beobachteten primären Dreieck und der darin entstehenden triadischen Beziehung Hypothesen über das Beziehungsmuster und die sich darin entwickelnden Ressourcen und Symptome bilden.
Teil V beschreibt Methoden und Techniken der Familiendiagnostik. Viele von ihnen sind schon lange bewährt und gehören zum Standard in der therapeutischen Arbeit mit Familien.
Zur Einführung gibt es ein Kapitel über Familienerzählungen in der Therapie und die sich dabei herauskristallisierenden Familiennarrative. Diese präsentieren sich in verschiedenen Formen, aber immer sind es Geschichten, die das „So-sein“ einer Familie für die Familie selbst und die von außen kommenden BeobachterInnen inszenieren und begründen. Folgen wir ihnen, offenbaren sich (transgenerationale) Muster, die aktuelle Themen, Probleme, Konflikte verstehbar machen und auch Hinweise auf mögliche Lösungen und die dafür vorhandenen Ressourcen enthalten. Im darauf folgenden Kapitel wird die Perspektive gewechselt. Nun sollen nicht primär die Worte sprechen, sondern der Körper und die in der Aktion entstehenden Gefühle, Affekte und Empfindungen. Methoden hierfür sind Skulpturen, Familienzeichnungen (z.B. Familie in Kreisen) und symbolische Darstellungen (z.B. Familie in Tieren). Im Wohnungsgrundriss entsteht ein räumliches Bild zu den Familienbeziehungen, das eine Vielzahl von Assoziationen, Erinnerungen, Emotionen weckt , ebenso wie das von Kurt Ludewig entwickelte Familienbrett. Auch die Phantasie als Eintrittsmöglichkeit in eine erfahrungserweiternde „Surplus-Reality“ (Jakob L. Moreno) lässt sich methodisch fördern, z.B. durch Märchen, Handpuppen oder den altbewährten Szenotest. So kommen wir im diagnostischen Gespräch weit über die Sprache hinaus.
Teil VI ist wissenschaftlich besonders anspruchsvoll. Hier werden Beobachtungs-, Befragungs- und Gestaltungsverfahren und die dazugehörigen Formen der Datenerhebung vorgestellt: strukturierte und offene Interviews, Beobachtung der familiären Interaktion mittels vorgegebener Kategorien (z.B. Häufigkeit der Interaktion zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern), Einordnung von Beobachtungen in ein graphisch dargestelltes Systemmodell (z.B. das Circumplexmodell von Olson et al.) Ratingskalen und Fragebögen.
Für den konkreten familientherapeutischen Alltag sind sie zu aufwendig, aber sie bieten durchaus Anregungen, das eigene therapeutische Vorgehen zu strukturieren und zu dokumentieren.
Zum Abschluss:
1. Durch die Entscheidung für ein Handbuch gelingt es der Autorengruppe, die Komplexität der systemisch-mehrgenerational-psychodynamischen Diagnostik durch die Verteilung der verschiedenen Themen auf unterschiedliche Kapitel zu reduzieren. Durch die Verteilung der einzelnen Themen auf die relativ kurzen und inhaltsreichen Artikel wird dann die Komplexität auf anderem Wege wieder hergestellt. Durch das Stichwortverzeichnis und ausführliche Inhaltsangabe kann man immer, wenn Bedarf entsteht, sich einem Thema zuwenden und u.a. durch die Literaturhinweise am Ende jedes Artikels auf die weitere Suche nach Informationen gehen.
2. Das Buch ist integrativ angelegt und zeigt die Bereitschaft der Herausgeber, nebeneinander bestehende Theorie-Praxis-Konzepte im Hinblick auf das Thema der Diagnostik zusammenzuführen und dennoch die eigene Metatheorie als prominenten Referenzpunkt zu erhalten. Das ist mir besonders beim Thema Pathologie- vs. Ressourcenorientierung aufgefallen: man kann der einen Perspektive folgen und die andere mit in die hypothetische Beschreibung familiärer Wirklichkeiten integrieren.
3. Jedes Kapitel beginnt mit einem einleitenden Überblick. Das ist didaktisch sehr günstig, weil man dann schon einen Rahmen für das Lesen und Verstehen des nun folgenden Textes im Kopf hat.
4. In jedem Kapitel gibt es mindestens einen optisch hervorgehobenen Block, in dem zu den Beschreibungen des Kapitels passende „Diagnostische Fragen“ aufgeführt werden. Das ist für die alltägliche Therapiepraxis sehr hilfreich.
Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Selbstverständigung und theoretisch-praktischen Begründung der Familientherapie. Es umspannt deren Entwicklung in den letzten letzten sechzig bis siebzig Jahren und birgt in sich einen in dieser Zeit gesammelten Schatz professioneller therapeutischer Erfahrungen, des erarbeiteten praktischen Wissens und der theoretischen Reflexion. Kurt Lewin wird der Satz zugeschrieben: Nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Diese leitet uns durch das Dickicht unserer Wahrnehmungen, Gedanken und Emotionen, indem sie zum Unterscheiden (griech. „diagignoskein“), Ordnen, Strukturieren und vor allem zum Fragen verhilft. Diagnostik ist primär – zumindest systemisch gesehen – kein Verfahren zur Erstellung von Krankheitsbefunden, sondern ein durch theoriebasierte Fragen strukturierter, in einem Beziehungskontext stattfindender und letztlich immer unabgeschlossener Prozess. In diesem gewinnen wir praktische Erkenntnisse über Probleme und hoffentlich für ihre Lösung hilfreichen Ressourcen.
Hierfür ist dieses Buch sehr wertvoll, ich möchte sogar sagen: unverzichtbar – sowohl für die NeueinsteigerInnen in das familientherapeutische Feld, als auch für die darin schon langjährig tätigen KollegInnen. Und es könnte auch die Arbeit der VertreterInnen anderer Therapierichtungen, in der Psychiatrie, der Sozialarbeit und der Sozialpädagogik bereichern.

Günter Reich, Michael Stasch, Joachim Walter & Manfred Cierpka (Hrsg.)(2024): Handbuch der Familiendiagnostik, 4. Aufl. Berlin/Heidelberg (Springer)
490 S., Softcover
ISBN: 978-3-662-66878-8
Preis: 59,99 (Softcover), 49,99 ebook
Verlagsinformation:
Mit diesem komplett überarbeiteten Handbuch können Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten den diagnostischen Prozess in der Arbeit mit Familien Schritt für Schritt nachvollziehen. Vom ersten Telefonkontakt über die Durchführung der Gespräche bis hin zur klinischen Dokumentation: Dieses Buch enthält alle Fakten und Informationen für Ihre tägliche Arbeit. Ein Leitfaden für die Gesprächsführung unterstützt Sie praktisch. Beispiele illustrieren und erläutern den theoretischen Hintergrund. Der interdisziplinäre Ansatz gewährleistet, dass systemische, psychoanalytische, strukturelle und verhaltenstherapeutische Konzepte zur Anwendung kommen. Von den Grundlagen über Therapieverfahren bis hin zu speziellen Situationen werden alle Aspekte der Familiendiagnostik in ihrer praktischen Anwendung dargestellt. Aus dem Inhalt: Grundlagen – Familienerstgespräch: Vorbereitung, Durchführung, Auswertung, Beispiel – Die diagnostischen Fenster – Besondere Aspekte und Techniken der Familiendiagnostik – Empirisch-diagnostische Methoden.
Über die Herausgeber:
Prof. Dr. Günter Reich, ehem. Leitender Psychologe, Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Michael Stasch, Dipl.-Psych., Psychoanalytiker und Familientherapeut, Heidelberg. Dr. Joachim Walter, Chefarzt Kinder- und Jugendpsychiatrie, Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Hamburg. Prof. Dr. med. Manfred Cierpka (+), Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Psychoanalytiker und Familientherapeut, Heidelberg.

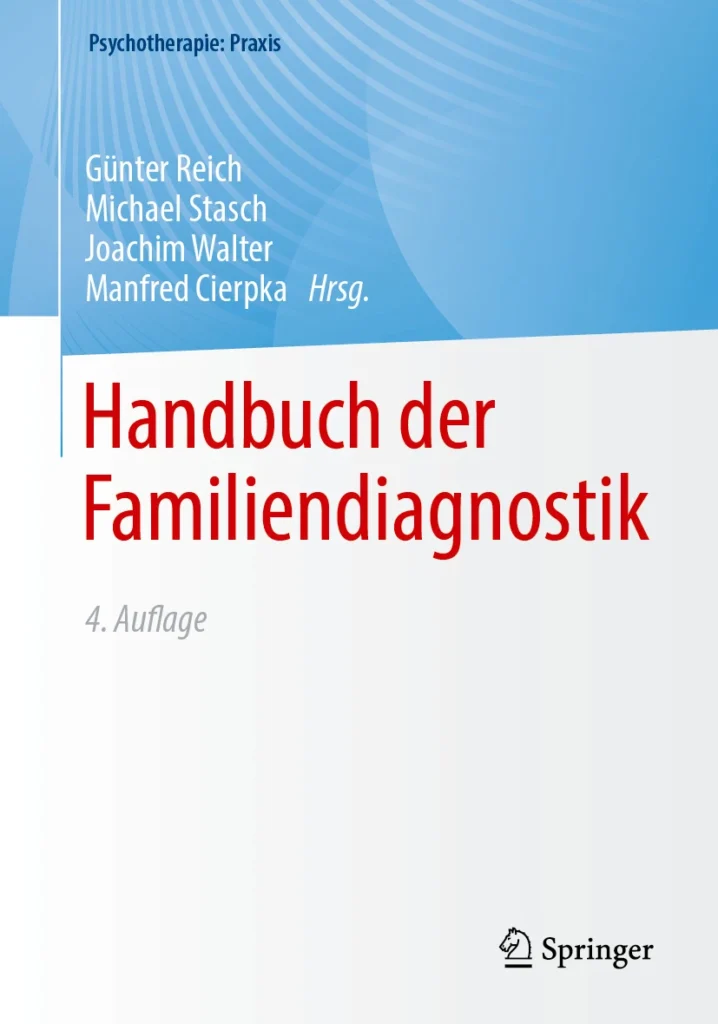

Ein sehr wichtiges Buch gerade auch für die Ausbildung in systemische Psychotherapie im Rahmen der Approbation.
Was für eine tolle Rezension, danke, Jan Bleckwedel