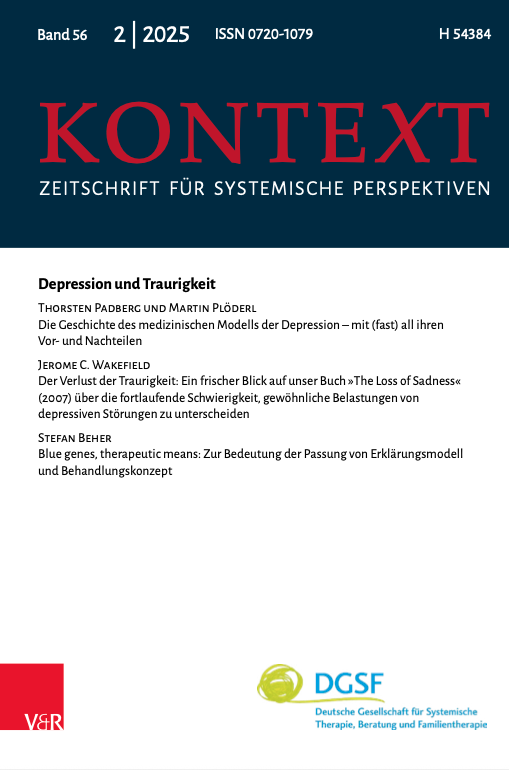
Die Ausgabe 2/2025 der Zeitschrift KONTEXT steht unter dem Leitthema „Depression und Traurigkeit“. Es ist das letzte Heft, das unter der Herausgeberschaft von Stefan Beher erscheint. Diese Tatsache ist sehr bedauerlich. In seinem Editorial schreibt er dazu: „Ich bin bereits zu Beginn des Jahres aus dem Herausgeberteam ausgeschieden, nach einem organisierten und für Außenstehende kaum vorstellbaren Proteststurm gegen eine von mir in Heft 3/23 veröffentlichte Buchrezension, nicht zuletzt auch gegen meine Person. Die Geschehnisse habe ich als eine enorme Zumutung erlebt, sowohl auf der Sach-, wie auch auf der Beziehungsebene. Sie führten schließlich auf die Konsequenz, dass meine Tätigkeit als Herausgeber in einer Weise eingeschränkt werden musste, die ich nicht zu akzeptieren bereit war, auch wenn sie allein zum Schutz meiner geschätzten, jetzt ehemaligen Mitherausgeber vor weiteren Angriffen (und deren Unterstützung bis in die Führungsebene der DGSF hinein) wohl unausweichlich gewesen ist[s.a. hier und hier (TL)]. Das Konzept zu diesem Band über Depression und Traurigkeit, den Sie hier in den Händen halten und den ich, nunmehr als Gastherausgeber, allein verantworte, stammt also, wenn Sie so wollen, noch aus froheren Zeiten. Sie lesen nun in meinem Abschiedsheft – und werden von mir an dieser Stelle künftig nichts mehr lesen. Ich wünsche Ihnen ganz ungeachtet dessen eine inspirierende Lektüre – und alles Gute, denn das Leben geht, wie auch hoffentlich der KONTEXT, ganz abseits von all solch unerfreulichen Umständen bekanntlich einfach weiter.“
Inhaltlich geht es in diesem Heft um ein klassisches Thema des systemischen Diskurses, nämlich um die Bedeutung von Diagnosen und Diagnostik, beispielhaft an der Depressionsdiagnostik diskutiert, die durcch die letzte Fassung des DSM-V noch einmal ausgeweitet wurde und nunmehr auch eine verlängerte Traurigkeit nach Verlusten umfasst. Thorsten Padberg und Martin Plöderl zeichnen in ihrem Titelbeitrag die Geschichte des medizinischen Modells der Depression nach. Sie diskutieren dessen wissenschaftliche Grundlagen, Vorteile – etwa die Entstigmatisierung durch ein Krankheitskonzept – und Nachteile wie eine mögliche Vernachlässigung psychosozialer Faktoren. Der für seine pharmakotherapeutische Orintierung bekannte Claus Normann von der psychiatrischen Uniklinik in Freiburg erwidert auf diesen Aufsatz mit einer ausgesprochen polemischen Verteidigung der biologisch-psychiatrischen Sichtweise und betont die Wirksamkeit kombinierten Vorgehens aus Psychotherapie und Pharmakotherapie. Padberg und Plöderl antworten mit einer Replik, in der sie die mittlerweile nicht mehr aufrechterhaltenen Serotonin-Hypothese, die geringe Effektstärke vieler Antidepressiva und das Risiko einer Medikalisierung vertiefen.
In einem zweiten Block wirft Jerome C. Wakefield in einem umfangreichen Beitrag einen frischen Blick auf sein Buch „The Loss of Sadness“ von 2007. Er zeigt, wie alltägliche Trauer in modernen Diagnosesystemen als depressive Störung fehlinterpretiert wird, und plädiert für eine sorgfältigere Unterscheidung. Isabella Heuser von der Charité in Berlin reagiert darauf mit einer pointierten Polemik, in der sie die Rolle biologischer, insbesondere epigenetischer Faktoren betont und vor einer Bagatellisierung leichter Depressionen warnt. Wakefield wiederum antwortet auf Heusers Kritik und verteidigt die Notwendigkeit, normale Traurigkeit nicht vorschnell zu pathologisieren.
Stefan Beher schließlich rundet den Themenschwerpunkt mit „Blue genes, therapeutic means“ ab. Er zeigt, wie eng das Behandlungskonzept an das jeweils zugrunde gelegte Erklärungsmodell geknüpft ist, und erläutert, warum genetische Deutungen sowohl entlasten als auch die Selbstwirksamkeit schwächen können.
Die aktuelle Ausgabe bietet auch Lesern, die sich bislang wenig mit diesem komplexen Feld beschäftigt haben, einen sehr lesenswerten und facettenreichen Einstieg in den diagnostikkritischen Diskurs.
Neben den üblichen Rezensionen gibt es auch im aktuellen Heft wieder die vertraute Rubrik „Stich-Wort“, die dieses Mal (zum Begriff der Hilfsbereitschaft) allerdings eher im Gewand einer recht pathetischen Predigt (von Helmut Kuntz) daher kommt.
Alle biografischen Angaben und abstracts sind hier zu finden…

